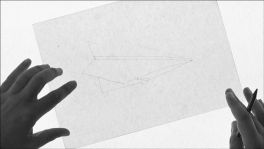„[E]ine echte, erfahrene Metapher“ – „in welchem Medium oder welcher Form auch immer“
Denkbilder zur Verschränkung von Erzählung und Erfahrung und ihre politische Bedeutsamkeit
One week following Israel’s invasion of Lebanon in 1982, a pilot in the Israeli air force named Hagai Tamir flew over the site of the Saida Public Secondary School for Boys, near Ain El-Helweh and refused an order to bomb it. He said: „It takes a lot longer to build a city than it does to strike a target.“Being an architect as well as a pilot, he could tell that the building was either a school or a hospital. He turned around and dropped his bombs over the sea. The school was bombed a few hours later by another pilot.[1]
Im Libanonkrieg von 1982, so wird erzählt, habe ein Pilot der israelischen Luftwaffe beim Anflug auf die südlibanesische Hafenstadt Saida erkannt, dass sein Abschussziel ein ziviles, eine Schule oder ein Krankenhaus, sei, woraufhin er seine Maschine abgedreht und seine Bomben über dem Meer abgeworfen habe. Seine Befehlsverweigerung ‚machte Geschichte‘ – nicht in dem Sinn, dass sein Handeln den Verlauf des militärisch ausgetragenen Konflikts unmittelbar hätte beeinflussen können, denn das Ziel wurde unwesentlich später von einem anderen Piloten bombardiert; wohl aber in dem Sinn, dass seine Geschichte, einmal erzählt, nicht wieder aus der Welt zu kriegen war.
Dreißig Jahre später nimmt Akram Zaatari in seiner Arbeit Letter to a Refusing Pilot (2013) die Geschichte wieder auf und erzählt sie fast beiläufig in einer filmischen Montage aus Bildern, die seinem Familienalbum entstammen, aus Luftaufnahmen, Szenen aus einem Schulalltag, Texteinschüben und Sequenzen, die Hände im Umgang mit dem Bildmaterial zeigen (Abb. 1-4). Die Geschichte einer Verweigerung, die als wahre Begebenheit gemessen am Kriegsgeschehen klein, als übertragbare Nacherzählung gemessen an der Potentialität und Handlungsfähigkeit im Rahmen von Geschehnissen aber groß erscheint, bildet den Dreh- und Angelpunkt von Zaataris Arbeit – trotz oder vielmehr gerade wegen ihrer fast beiläufigen Form. Denn im Unterschied zu einer sorgfältigen Rekonstruktion der Komplexität der historisch nachweisbaren Geschichte, wie sie etwa Noah Simblist in seinem dreiteiligen Essay Two Point Perspective (2016) zu Zaataris Arbeit leistet[2], besteht die Stärke der künstlerischen Arbeit hier in ihrer Konzentration auf die Konkretheit als Fabel – eine paradox anmutende Formulierung, mit der ich die Spannung zwischen singulärem Ereignis und mythischem Erzählmuster anzusprechen versuche. Letter to a Refusing Pilot trägt einen anonym bleibenden Adressaten im Titel, was jedoch mit der Erzählweise kontrastiert, in der found footage-Material, Fotografien aus Zaataris Kindheit sowie Kalendereinträge als indexikalische Belege einer (persönlich) verbürgten Vergangenheit inszeniert werden.[3]
Es ist diese Verschränkung von Erzählung und Erfahrung, mit der ich mich im Folgenden beschäftigen und die ich mit zwei Positionen in Verbindung bringen möchte, welche sie als eine Art ‚Metaphernarbeit‘ herausstellen: ein Arbeiten der Metaphern, das Verbindungen zwischen Körper und Sprachbild herstellt, insofern der Körper derjenige ‚Ort‘ ist, an dem sich Aktualität (in Form von Wahrnehmung) und Vergangenheit (in Form von Gedächtnis, bewusst oder unbewusst) auf heterochrone Weise verbinden.
Zum einen möchte ich – gestützt auf Walter Benjamins Denkbild Romane lesen (1931–1933), in dem sich verschiedene Stränge seiner Beschäftigung mit Erfahrung und Erzählung zu der Formulierung einer „echte[n] erfahrene[n] Metapher“ verknoten – auf die körperliche Responsivität zu sprechen kommen, durch die sich das Rezeptionsereignis nach Benjamin auszeichnet.[4] Zum anderen möchte ich Mieke Bal heranziehen, nicht nur weil sie die besondere Ästhetik von Videoinstallationen als Mise en Scène theoretisiert und dies als „konzeptuelle Metapher“ für die Verschränkung von künstlerischem Bildraum und subjektivem Erfahrungsraum präzisiert[5], sondern auch, weil sie Metaphern an anderer Stelle als eine aktive Form reflektiert, durch die sich intersubjektive Transferprozesse ereignen.[6] Ausgehend von diesen beiden Positionen lässt sich ein Nachdenken über die Wirksamkeit von Metaphern im visuellen Feld mit der Frage verbinden, welche Art von Beziehung Werk und Betrachtung hier im buchstäblich zeit-genössischen Sinn eingehen, indem sie Zeit miteinander teilen.
Wor(l)d Experience – Wieder- und Weitergabe von
Welterfahrungen
Word or sign versus world? Surely this difference would be unacceptable to art that works precisely in order to make the former an active intervention into the latter.[7]
Wie Simblist darlegt, beschäftigt sich Zaatari bereits seit Längerem mit der Geschichte von dem sich weigernden Piloten[8], die er schon als Kind kennenlernte und auch 2010 in einem Gespräch mit dem israelischen Filmemacher Avi Mograbi erwähnt: A Conversation with an Imagined Israeli Filmmaker Named Avi Mograbi (2012 in Heftform publiziert).[9] Bereits der Titel erklärt, was Zaatari im Vorwort dann noch weiter ausführt: Sowohl die Position des Regisseurs als auch seine eigene sollen als Imagination, als Rolle gelesen werden, als Teil eines Skripts, „playing roles that have been prescripted for us by a situation, like characters in a play or film, and like two individuals born in two enemy states.“[10] Die Betonung des Skripts, das bereits alle Rollen zugewiesen zu haben scheint und folglich kaum individuelle Handlungsfreiheiten ermöglicht, ist aber nicht nur eine strukturelle Betrachtung, die die Einschränkungen des eigenen Handlungsrahmens thematisiert und bestenfalls als melancholischer Kommentar verstanden werden könnte. Sie wird von Zaatari auch für eine explizite Übertragung genutzt:
This conversation will not be recorded, and if it ever happens again, other individuals will play these roles, with the same script, using the same names. Two fictive individuals supposedly from two enemy states reflect on their past, and their perception of each other.[11]
Durch die ‚Fiktionalisierung‘ der eigenen Person wird diese zu einem Angebot an die Betrachtenden und Nachfolgenden. Sie wird zu einer Form, die eingenommen werden kann, wobei Zaatari den Moment der Wieder- und Weitergabe in der Art eines Staffellaufs betont – etwas wird entgegengenommen und weitergereicht: Fiktion oder Dokument? Ähnlich den ästhetischen Strategien der Atlas Group und ihren Arbeiten zum Libanonkrieg führt Zaataris Werk hier an den Punkt, an dem eine tatsächliche Unterscheidbarkeit von Fiktion und Dokument nicht nur nicht möglich ist, sondern auch nicht sinnvoll wäre, weil sie die Logik der Mitteilbarkeit seiner Geschichte(n) behindern würde. Denn entweder wäre es dann am Ende einfach seine oder eine Geschichte, aber nicht mehr länger jene beunruhigende Form, die aus der Unsicherheit über den Status entsteht und nach der Verbindung mit der je eigenen Geschichte suchen lässt.
„This conversation will only be a script, as a tribute to cinema, as a celebration of uncertainty and of how life and film can possibly reproduce.“[12] Zaatari gibt an, schon früh ein passionierter Filmliebhaber gewesen zu sein, löst hier aber die konstatierte fertile Verknüpfung von Leben und Film aus der konkreten biografischen Erzählung und erklärt sie zu einem Modell für die Verschränkung von kollektiven Erzählräumen und individuellen Biografien. Dazu noch einmal Zaataris Geschichte(n): Seth Anziska, ein amerikanischer Historiker mit Schwerpunkt Nahost-Konflikt, las Zaataris Conversation während einer Recherche bei der Arab Image Foundation und bemerkte, dass ihm die Identität des Piloten zufällig bekannt war – er vermittelte daraufhin einen Kontakt zwischen Zaatari und Haggai Tamir.[13] Simblist kontextualisiert die Arbeit Zaataris kenntnisreich durch Angaben zur politischen Situation im Libanon und in Israel damals wie heute und schildert die Geschichte ihres Dialogs unter den dadurch erschwerten Bedingungen.[14]
Die Videoinstallation Letter to a Refusing Pilot aber unternimmt etwas anderes. Die Betrachtenden werden nicht möglichst umfassend über die angesprochenen Situationen informiert. Sie werden aber auch nicht zu Zaungästen eines bereits geführten Gesprächs gemacht, sondern im übertragenen Sinn selbst in dieses einbezogen. Diese Form der Involvierung verdankt sich wesentlich dem Wirken eines hier audiovisuell metaphorischen Erzählens – nicht nur thematisch, sondern auch technisch. Im Unterschied jedoch zu einer technischen Auffassung, die den Effekt und die Frage seiner Kalkulierbarkeit als manipulative Basis kritisch in den Fokus rückt, wie etwa die systematische Studie Audiovisuelle Metaphern. Zur Körper- und Affektästhetik in Film und Fernsehen (2010) von Kathrin Fahlenbrach[15], geht es mir an dieser Stelle um einen bewussten Umgang mit der Unmöglichkeit ‚nicht-manipulativen‘ Bildgebrauchs und um die politische Arbeit damit an der Schnittstelle von ‚Ich‘ und ‚Du/Wir‘, durch die sich Werke wie die Zaataris auszeichnen. Denn wie auch Simblist anmerkt, vermittelt Zaataris Bildarbeit zwischen direkten und indirekten, buchstäblichen und metaphorischen Momenten, zwischen Fakt und Fiktion, zwischen damals und heute:
Letter to a Refusing Pilot self-consciously uses a number of literal and metaphorical points of view. The opening image of the video was made by strapping an HD camera onto a drone that rose above a building. With this move, Akram Zaatari both reclaims and references the fact that throughout his childhood the sky above southern Lebanon was controlled by the Israeli army.[16]
Auch wenn mir die Assoziation zur militärischen Luftraumkontrolle an dieser Stelle (noch) nicht zwingend erscheint, lohnt es sich aus meiner Sicht, die vorgeschlagene Fährte aufzunehmen und weiterzuverfolgen, nämlich die Frage, inwiefern die audiovisuelle Arbeit buchstäbliche und metaphorische Blickpunkte verwendet und auf Betrachtende überträgt. So übernimmt die an einer Drohne befestigte Kamera zu Beginn vor allem eine dynamische Blickführung: Aus der Nähe zum Boden des Daches, auf dem die Drohne startet, und durch ihre starke Bewegung bleibt das Bild zunächst unscharf und wirkt destabilisierend, bevor der ‚Blick‘ der Drohne schließlich an Höhe und Überblick gewinnt. Ähnlich den Funktionen, die eine narrative Kameraführung im Erzählfilm übernimmt, nutzt auch Zaatari verschiedene Einstellungen, die ein jeweils anders geartetes Betrachtungsverhältnis schaffen und vermutlich nur selten bewusst als Formen der Blicklenkung registriert und unterschieden werden – wie beispielsweise die Kamera, die mechanisch wirkt und einen langanhaltenden Schwenk vollzieht, die Kamera, die einer Handlung folgt, frontale Einstellungen mit Stativ oder bewegte, wie die der Drohne. Diese Formen der Kameraarbeit als metaphorisch zu betrachten, setzt aber einen entsprechenden Metaphernbegriff voraus, der die Logik der damit verbundenen Transferprozesse erfasst. Dem möchte ich versuchen, weiter nachzugehen.
„I am subjected to its magic“ – Videoinstallationen,
Subjekttheorie und ein ‚neues‘ Wirklichkeitsverständnis
Zum passionierten Schauen bekennt sich nicht nur Zaatari, der sich überdies auf Jean-Luc Godard bezieht[17], sondern auch Mieke Bal, wenn sie schreibt, dass sie nicht wisse, was es sei, das sie an Videoinstallationen so fessele, aber sie fühle sich regelrecht verzaubert und könne sich der Wirkung der sie umgebenden, flimmernden Bilder nicht entziehen. Was die englische Sprache in Bals Aussage, „I am subjected to its magic“[18], explizit macht, nämlich dass das Subjekt ein Unterworfenes ist, war in den ästhetischen und medienreflexiven Diskursen der 1990er Jahre eine zumindest im Umfeld poststrukturalistischer Theoriebildung oft erklärte Gewissheit. Die Debatten konkret in Erinnerung zu rufen, fehlt hier der Raum; wichtig aber scheint mir dennoch, an die Frage der künstlerischen Reflektier- und Verhandelbarkeit von Subjektpositionen, von Subjektivierungsweisen und -techniken, anzuschließen und ihr Verhältnis zum metaphorischen Erzählen (und Denken) in den Blick zu nehmen.[19]
Bals Bekenntnis zur magischen Gefangennahme durch die Videoinstallation ist eine Affirmation immersiv wirkender Bildarbeiten, die den Kontrollverlust des Subjekts nicht per se ablehnt und unter Ideologieverdacht stellt, sondern als konstitutiven Teil von Subjektivierung anerkennt und nach den Möglichkeiten ästhetisch-politischer Arbeit damit fragt.[20] Denn wie Bal an anderer Stelle am Beispiel der Darstellung psychotischer Zustände in den Videoinstallationen von Eija-Liisa Ahtila ausführt, ist die Gefangennahme durch die Magie der Videoinstallation und das resultierende ‚Sich-Forttragen-Lassen‘ eine Metapher für ein „Sich-Einlassen auf die Welt“ – was eindringlich mit dem Schweben der Protagonistin in Ahtilas The House (2002) korrespondiert, auch wenn Bal das in ihrem Bezug auf diese Arbeit nicht expliziert.[21]
Bal, die hier die „kulturelle Kraft“[22] des Affekts theoretisiert und für eine politische Ästhetik reklamiert, bringt damit einen Perspektivenwechsel gegenüber der verlässlichen ‚Oppositionierung‘ von Experimentalfilm und Hollywood in Anschlag. Cinematische Videoinstallationen, wie sie seit den 1990er Jahren international zu einer der vorherrschenden künstlerischen Formen geworden sind, arbeiten mit ähnlichen Effekten wie das Kino, das seinerseits bereits auf die Tradition illusionistischer Theaterpraxis aufbauen konnte: Dunkelheit, die ein ungestörtes Schauen unterstützt und die Anwesenheit anderer Zuschauerinnen und Zuschauer vergessen macht, großformatige Bilder, die überwältigend wirken, ein durch Schnittfolgen in Fluss gehaltener Erzählstrom, der eine Konzentration auf einzelne Sequenzen fast unmöglich macht usw. Eine klare Separierung von anti-illusionistischen, dekonstruktiven, die Bedingungen ihrer Herstellung offenlegenden Bildern und solchen, die mit der verführenden Macht magisch wirkender Effekte und mythischer Traditionen arbeiten, scheint hier nur selten möglich und aus kritischer Perspektive auch nicht mehr sonderlich attraktiv. So betont etwa Lotte Everts in ihrem Beitrag zu Kunst und Wirklichkeit heute (2015), dass es ihr wichtig sei, die Arbeiten Eija-Liisa Ahtilas als „affirmativ“ zu betrachten, „kritisch aber nicht kritizistisch“, was meine, dass sie sich nicht skeptisch gegenüber der Vorstellung einer „intersubjektiv miteinander teilbare[n] Wirklichkeit“ verhielten.[23] Ahtilas Arbeiten ermöglichen Everts zufolge, die Perspektive eines Anderen zu erfahren. Als Motto stellt sie Merleau-Ponty voran: „Es sind Gesichter, Gebärden, Worte, auf die wir mit unseren Blicken, Gebärden und Worten antworten, ohne ein Denken dazwischen zu setzen […]; jeder trägt die Anderen in sich und wird durch sie in seinem Leib bestätigt.“[24]
Bleibt zu fragen, was mit der erneut affirmativen Haltung für die Kritik gewonnen werden soll. Deutlich tritt zwischen den Zeilen die politische Erwartung oder auch Hoffnung hervor, dass ein sich aus der distanzierten Betrachtung lösender Blick die Entfremdungen in der Moderne überwinden könne und eine andere Nähe, eine andere Form der Weltzuwendung ermögliche. Wirklichkeit heute – in seiner Einleitung konstatiert Johannes Lang, zusammen mit Lotte Everts, Michael Lüthy und Bernhard Schieder Herausgeber des Bandes, dass es um die „Rehabilitierung einer eigengesetzlichen, aber deshalb nicht unveränderlichen Wirklichkeit und ihrer prinzipiellen Erfahrbarkeit und Erkennbarkeit“ gehe, die die Fragen nach den Bedingungen, wie sie die gesellschaftskritische Kunst gestellt hätte, durch solche der gestaltenden Erforschung und Teilhabe ablöse.[25] Aber ist das eine gelungene Alternative?
Affekte, Materialitäten und allgemein die Dinge – Spekulationen über Vorsprachliches, Ungetrenntheiten und Nichtmenschliches erfreuen sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit und werden als notwendige Überwindung rationalistischer Übel der Moderne verstanden, für die zuletzt auch noch Formen von Gesellschaftskritik und Sprachtheorie verantwortlich gemacht werden.[26] Und wie kaum anders zu erwarten, ist die Gegenwart in ihrer Selbsttheoretisierung hier nicht übersichtlicher als etwa in der Diskussion um die vormalige Frage, ob es eine Postmoderne gäbe, die diesen Namen verdient. So enthält auch der hier beispielgebende Band Kunst und Wirklichkeit heute unterschiedliche Ableitungen, Herkünfte sowie Überzeugungen und lässt sich nicht als einstimmig betrachten. Richard Hoppe-Sailer etwa erhebt Einspruch und erinnert daran, dass auch die aktuellen Versuche nicht ohne Vorgänger sind, die es zum Vergleich heranzuziehen lohnt, um die romantischen Ideale bestimmen und differenzieren zu können.[27]
Wenn ich in diesem Zusammenhang nun auf ein Denkbild Benjamins eingehen möchte, so genau deswegen, weil er bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Fortleben romantischer Denkfiguren gerungen hat und sich um Differenzierungen bemühte, die mir auch für die gegenwärtig drängenden Versuche relevant erscheinen – und auch, weil sich daraus, wie ich später anschließen möchte, eine reizvolle Analogie zu Bals passioniertem Video-Schauen ergibt.
Romane lesen = Bücher verschlingen = ein Denkbild zur ‚Echtheit‘ von Erfahrung und Metapher
In den Denkbildern Benjamins – welch treffendere Bezeichnung für eine kognitive Metapher könnte es geben? – findet sich ein Kleines Kunst-Stück mit dem Titel Romane lesen. Zu diesem kurzen Text, der zu Benjamins Lebzeiten nicht mehr publiziert wurde, fanden sich im Nachlass zwei als „Vorstufe[n]“ bezeichnete Varianten, die das zentrale Thema – „diese Analogie, die der Roman zur Speise hat“[28] – an je unterschiedlichen Stellen genauer zu fassen versuchen, weswegen ich sie hier verschränkt miteinander lesen werde. Die erste Variante hebt an:
Versuch, mit einigen Notizen diesen Gedanken aufzuhelfen, die mich seit längerem beschäftigen: warum man Romane liest. Romanlesen das ist wie „Essen“. Also eine Wollust der Einverleibung. Mit anderen Worten der denkbar schärfste Gegensatz zu dem, was die Kritik gewöhnlich als die Lust des Lesers annimmt: nämlich die Substitution.[29]
Der hier zunächst rätselhaft anmutende „denkbar schärfste Gegensatz“ zwischen der „Wollust der Einverleibung“ und der „Lust des Lesers […]: nämlich die Substitution“ erklärt sich vor allem durch die Kenntnis der anderen Varianten, in denen Benjamin eine ähnliche Gegenüberstellung betont, statt von „Substitution“ aber von „Einfühlung“ spricht und in Variante zwei erklärt:
Der Leser versetzt sich nicht an die Stelle der Hauptfigur, sondern er verleibt sich ein, was ihr zustößt. Der anschauliche Bericht davon aber ist die appetitliche Ausstaffierung, in der ein nahrhafter Gang auf den Tisch kommt.[30]
Wollust der Einverleibung versus Lust der Einfühlung – der Gegensatz, den Benjamin hier argumentativ aufzubauen versucht, scheint in der darin zum Ausdruck kommenden unterschiedlichen Auffassung vom Subjekt beziehungsweise dem unterschiedlichen Verhältnis zum Subjekt zu liegen. Dabei ist hier nicht von Interesse, ob Benjamins Einfühlungsbegriff an dieser Stelle ‚richtig‘ ist – diese Frage würde seine Aussage verfehlen, denn Benjamins Begriffsarbeit ist, wie kaum eine Studie zu ihm einleitend anzumerken vergisst[31], keine definitorische oder konsistente, sondern eine performativ argumentative (poetische[32]): Die Trennschärfe und Präzision der Begriffe muss sich an jeder Stelle aufs Neue herstellen, um einen Gedanken zu formulieren. Folglich lese ich an der zitierten Stelle den gesuchten Kontrast: Die Wollust als triebhafte oder auch rauschhafte Ausprägung (sexueller) Lust spricht eine pathische Dimension körperlicher Hingabe an, ein ekstatisches Moment der Selbstvergessenheit, Auflösung und Verschmelzung; die Lust der Einfühlung erscheint demgegenüber willentlich herbeigeführt, das heißt quasi als Ausdruck von (sexueller) Lust mit Verstand; die Wollust steht für ein eruptives Ereignis der Grenzauflösung zwischen Subjekt und Objekt, die Substitutionslust dagegen für den Wunsch und den Genuss am ‚Ausflug‘, am kontrollierten Tausch der Positionen. Interessanterweise bezieht Benjamin nun in diese Unterscheidung zwischen einer pathischen, affektiven und einer empathischen, rationalen Dimension des Lesens von Romanen den Begriff der Metapher mit ein:
Man hat auch zu fragen, ob nicht „ein Buch verschlingen“ in solchem Sinne eine echte, erfahrene Metapher ist. […] Die älteste Ernährungs-theorie ist darum für die Erkenntnis des Romanlesens wichtig, weil sie vom Essen ausging: es hieß, wir ernähren uns durch Einverleibung der Geister der gegessenen Dinge. Nun ernähren wir uns zwar nicht dadurch, aber wir essen doch einer solchen Einverleibung wegen. Einer solchen Einverleibung wegen lesen wir auch, also nicht, um unsere Erfahrung, unsern Gedächtnis- und Erlebnisschatz zu erweitern. […] So einfach ist es nicht. Wir lesen nicht Romane um unsere Erfahrungen sondern um uns selber zu mehren.[33]
Gegensätze zwischen Ernährung im physiologischen Sinn und Essen im ‚magischen‘, zwischen sammelbaren Erfahrungen und etwas, das Benjamin als ein ‚sich mehren‘ bezeichnet: Deutlich dürfte sein, dass die Gegensätze, mit denen er hier operiert, nicht selbstverständlich sind, sondern sich einzig durch die Art und Weise erklären, wie sie hier eingeführt und gegeneinandergesetzt werden. Benjamin argumentiert nicht ausgehend von einem bereits gegebenen System, wie es beispielsweise das Begriffsregister eines fachdisziplinären Diskurses bietet, sondern greift mit seinem eher assoziativen denn eindeutigen Verweissystem auf historische Kenntnisse ebenso zurück wie auf Alltagserfahrungen. Etwas einfacher zugängig scheint mir diese Passage, wenn ich sie mit einer nahezu identischen Stelle aus seinem Rundfunkvortrag zu Kinderbuchliteratur ‚gegenlese‘. Dort leitet er den letzten Absatz ein: „Bücher verschlingen. Eine merkwürdige Metapher. Sie gibt zu denken.“ Und nachdem dann der bereits zitierte Absatz folgt, schließt er mit der Feststellung:
Ganz besonders aber und immer lesen die Kinder so: einverleibend, nicht sich einfühlend. Ihr Lesen steht im innigsten Verhältnis viel weniger zu ihrer Bildung und Weltkenntnis als zu ihrem Wachstum und ihrer Macht.[34]
Dieses Denkbild als metapherntheoretisch relevant zu erachten, verkompliziert sich durch die gleichsam doppelte Verwendung und Leserichtung, die Benjamin hier der Metapher gibt – was mich an Jaques Derridas Einstieg in seinen Text Der Entzug der Metapher (Le retrait de la métaphore, 1978) denken lässt, in dem er betont, dass über Metaphern nachzudenken nicht ohne ein Nachdenken in Metaphern möglich sei.[35] Mit Benjamin heißt das: Einerseits geht es um das Verschlingen als Metapher für etwas anderes, nämlich das Lesen (von Romanen); in dieser Form der Ersetzung aber geht es explizit um mehr als einen förmlichen Vergleich im Sinne einer rein sprachlichen Operation, in der ein Begriff durch einen anderen ausgetauscht wird; und dieses Mehr versucht er in den dann folgenden Ausführungen zur Einverleibung zu fassen zu bekommen, als ein körperliches, von der Erfahrung zum Denken zielendes. Mit dieser Bewegung aber, die eine Verklammerung zwischen körperlicher Erfahrung (auch Erfahrbarkeit) und Sprache in ihrem weitesten Sinn, das heißt als differenzierendes und kommunizierbares System, schafft, begründet er das Wesen der Metapher („echte“) in der Ansprache körperlicher Responsivität („erfahrene“). Dass man zu fragen habe, „ob nicht ‚ein Buch verschlingen‘ in solchem Sinne eine echte, erfahrene Metapher ist“, bringt die Dimension der Erfahrung als Notwendigkeit für den (Nach-)Vollzug der Metapher ins Spiel. Benjamins Formulierung verhält sich wie eine Metapherntheorie en miniature: Wenn die Echtheit der Metapher (ihre ‚Wahrheit‘) an ihre Erfahrbarkeit gebunden ist, dann in einem doppelten Sinn, denn das bedeutet, dass sie auf eine Erfahrung aufbauen muss, die bereits gemacht wurde, um sinnhaft werden zu können; dass sie zugleich aber zum Vehikel einer Übertragung wird, in der es darum geht, aktuell Sinn zu erzeugen, sprich erfahrbar zu machen. Über den förmlichen Vergleich hinaus soll es etwas geben, das den Sinntransfer, den die Metapher vornimmt, plausibilisiert, und das ist eine Ähnlichkeit, die erfahrbar (gewesen) sein muss – eine Erfahrung mit dem Verschlingen und eine mit dem Lesen, für deren Korrespondenz es keinen eigenen Begriff gibt, sondern lediglich die begriffliche Präzisierung im Moment der Übertragung, wie sie die „echte, erfahrene Metapher“ leistet.
„Der gute Schriftsteller sagt nicht mehr als er denkt. Und darauf kommt viel an. Das Sagen ist nämlich nicht nur der Ausdruck sondern die Realisierung des Denkens.“[36] Was Benjamin in dem anderen Kleinen Kunst-Stück unter der Überschrift Gut schreiben zu denken gibt, ordnet sich der Metaphernfrage hier in einer Weise zu, die meine Erklärungsversuche geradezu zum Scheitern verurteilt. Und dennoch, so abgeschlossen die Form der Denkbilder Benjamins sein mag, so offen ist ihr gedanklicher Anstoß. An dieser Stelle möchte ich mich deswegen von der genauen Lektüre Benjamins lösen, diese aber in Form einer Aufforderung mitnehmen, noch weiter über dieses ‚sich mehren‘ nachzudenken: Weder Einfühlung, Substitution, Bildung noch Weltkenntnis soll es sein, sondern ein ‚sich mehren‘, das vor allem Kinder schätzen und praktizieren, ein Zugewinn an Macht und Wachstum, durch eine Einverleibung dessen, was der Hauptfigur zustößt – eine gänzlich profane, aber nicht geringer als das Sakrale zu schätzende (Sprach-)Magie, die Erfahrung und Erzählung verbindet.
Zaataris Letter to a Refusing Pilot beschäftigt sich mit einer Erzählung und anderen Erinnerungen aus seiner Kindheit. Auch bei ihm hat die kindliche Wahrnehmung für das, was um ihn herum geschah und noch nicht im Sinne der erwachsenen Geschichte verstanden werden konnte, eine besondere Bedeutung. Ich möchte nun abschließend versuchen, mit Benjamins Aufmerksamkeit für die Übertragbarkeit von Geschichten und ihre Einverleibung auf Zaataris Arbeit zurückzukommen und Korrespondenzen herauszuarbeiten, die die in Metaphern leistbare Verschränkung von Erfahrung und Erzählung als Potential einer kulturanalytischen künstlerischen Praxis erkennbar werden lässt.
„Wahre Geschichten“ und ihre un/verständliche Form
In einem überaus bekannten Kinderbuch, das leider erst drei Jahre nach Benjamins Tod erschien, gibt es gleich zu Beginn eine Stelle, an der er seine Freude gehabt haben dürfte, weil sie ein so treffliches Bild einverleibter Stärke vermittelt. Ich zitiere in leicht gekürzter Form:
Als ich sechs war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das „Wahre Geschichten“ hieß. Auf dem Bild war eine Königsschlange, die gerade ein wildes Tier verschlingen wollte. […] In diesem Buch heißt es: „Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne zu kauen. Danach können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen sechs Monate zur Verdauung.“ Ich grübelte daher viel über die Ereignisse im Dschungel. Mit einem Farbstift gelang mir meine erste Zeichnung. […] Ich legte mein Meisterwerk den großen Leuten vor und fragte sie, ob ihnen die Zeichnung nicht Angst mache. Sie sagten: „Warum sollten wir Angst vor einem Hut bekommen?“ Meine Zeichnung stellte aber gar keinen Hut dar. Es war eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut.[37]
Aufgrund der frühen enttäuschenden Erfahrung mit der Unfähigkeit der „großen Leute“, zu imaginieren, und die verborgenen Inhalte von Formen zu sehen, so heißt es weiter, habe er das Zeichnen von offenen und geschlossenen Boas schließlich aufgegeben und gelernt, „Flugzeuge zu fliegen“. Akram Zaatari baut diese Stelle des Kleinen Prinzen (Le petit prince, 1943) von Saint-Exupéry zu Beginn seines Videos Letter to a Refusing Pilot ein (Abb. 5-7). Doch noch bevor Besuchende diese Sequenz in der Ausstellung zu sehen bekommen, sind sie bereits durch vier gerahmte Bleistiftzeichnungen an der Wand vor dem Raum (Abb. 8), in dem das Video gezeigt wird, indirekt mit der Frage des zeichnenden Kindes konfrontiert: Macht dir die Zeichnung Angst?
Im Video sind die Hände eines Mannes beim Anfertigen der Zeichnungen zu sehen (Abb. 9). Er setzt Striche ohne abzusetzen. Aber was wird damit bei Zaatari erzählt? Finde ich die Fährte zum Kleinen
Prinzen – die im Video durch das Aufschlagen des Kinderbuches eindeutig gelegt wird, nichtsdestotrotz aber auch auf eine Kenntnis der Geschichte angewiesen ist –, schreibt sie sich in die Deutbarkeit mit ein. Aber auch, wenn ich sie nicht erkenne, funktionieren die Zeichnungen als rätselhafte Anlage zwischen den größeren und leichter zu erkennenden Fotografien in den Ausstellungsräumen in ihrer Nachbarschaft. Sie lassen nach Referenzen suchen. Stärker noch als die Fotografie mit ihrem apparativ dokumentarischen Gestus verkörpern sie eine individuelle Spur und sind im konkreten wie übertragenen Sinn Spuren eines Geschichten-Lesenden – eines Romanlesers im Benjamin’schen Sinn?
Auf dem Lichttisch zeigt Zaatari auch alte Fotos aus seiner Kindheit, wie eine Textzeile im Video erzählt: „As a child, I spent most of my weekends with my family in the garden of Saida Public Secondary School for Boys, which my father founded near Ain El-Helweh, south of Saida.“[38] Dieser biografische Twist interessiert mich, weil ich die Arbeit an sich nicht als biografisch motiviert im engeren Sinn empfinde. Warum ihre Erzählweise davon abweicht, möchte ich hier abschließend darzulegen versuchen, weil damit für mich die eigentlich metaphorische Dynamik angesprochen ist.
Die Baumwollhandschuhe, in der musealen Logik ein sinnfälliger Schutz des zu Bewahrenden, bergen gegenüber den eigenen Kindheitserinnerungen ein eigentümliches Distanzierungsmoment und werden hier zum Bild einer unterbrochenen Berührung mit etwas, das im Archiv verstummt (Abb. 10). Am Rande findet man einige Hinweise darauf, dass es sich bei den in der Ausstellung gezeigten Fotos von Kassetten, Fotobrieftaschen, Aufklebern etc. um Erinnerungsstücke aus der eigenen Kindheit und Jugend handelt – so zeichnete Zaatari den Lärm der Bomber auf Tonbänder auf, fotografierte Panzer und Rauchfahnen, die auf Bombeneinschläge hinweisen, sowie seine Schwester am Klavier oder blühende Kakteen auf der Fensterbank. In der Ausstellung im Kunsthaus Zürich, in der ich die Arbeit zum ersten Mal sah, wurden die Besuchenden zunächst an den Fotografien vorbeigeführt, bevor sie im letzten Raum das Video Letter to a Refusing Pilot zu sehen bekamen, in dem ein junger Darsteller beim Hantieren mit einer analogen Kamera und einem Tonbandgerät gezeigt wird und damit die Position Zaataris visualisiert.
Alltag im Krieg: Davon erzählt vor allem der erste Raum mit den großformatigen Abzügen des Pocket-Albums, das aufgeblättert als Reihe gezeigt wird, inklusive des romantischen Coverbildes vorne und hinten, dessen eigentümlicher Rahmung nichts hinzugefügt werden kann (Abb. 11). Der Alltag selbst ist hier der erste Monteur. Im nächsten Raum hängen vereinzelt sorgfältig gefaltete Papierflieger an der Wand; Bilder, die nicht gezeigt werden, werden durch beschreibende Texte ‚heraufbeschworen‘; starke Vergrößerungen von Kampfjets aus einer Sammlung von Zeitungsfotos und jene einfachen Bleistiftzeichnungen, die Motive des dann anschließenden Videos vorwegnehmen, korrespondieren im Kontrast. Ein Saaltext führt die Geschichte vom israelischen Piloten ein, der ebenso wie der Künstler Architektur studiert habe, was ihn das Schuldach erkennen ließ, eine Geschichte, die der junge Akram Zaatari immer wieder und in immer weiteren Varianten in seiner Kindheit und Jugend erzählt bekam.
In der Ausstellung: Nachdem ich an all den Fotos bereits vorbeigegangen war, schließlich das Video, im Loop – Für mich begann es mit einer nahen Kamerafahrt um eine ovale, durchbrochene Marmorstatue in einem begrünten Innenhof (Abb. 12). Die Kamera lässt sich Zeit bei der erkundend anmutenden Umrundung, in der sich zunächst nur die Architektur im Hintergrund ändert. Dann dreht sie zurück, aber auch die Skulptur bewegt sich nun sichtbar mit, allerdings in einem anderen Tempo, so dass sich zwei auseinandertretende Bewegungen im Bild zeigen. Der Effekt ist ein versteckt surrealer, der das Bild von der dokumentarischen Form löst und eine andere Betrachtung nahelegt. Mit den auseinandertretenden Bewegungen vollzieht sich eine raumzeitliche Dynamik, die metaphorisch auch imaginäre Bewegungen, Bewegungen im Gedächtnis oder auch die Verschränkung von momentanem Wahrnehmungs- und Gedächtnisbild aufruft.
S/eine Geschichte
Was leistet das metaphorische Erzählen bei Zaatari? Was bringt die Durchmischung von imaginativen Rückblenden und faktischen Verweisen? Nach meinem Dafürhalten ist es der metaphorische Gebrauch realer Geschichte, durch den das Faktische geöffnet und übertragbar wird, wie umgekehrt aber auch das Faktische einem rein metaphorischen Verhältnis austauschbarer Zeichen widersteht und damit der Historizität zu ihrem Recht verhilft. Die ebenso semifiktionale wie semidokumentarische Erzählform Zaataris stellt damit ein spannungsreiches Verhältnis des Sowohl-als-auch wie Weder-noch her – ein Verhältnis, in dem die Erfahrung des einen durch ihre metaphorische Übertragung zur Erfahrung des anderen werden kann. Benjamin war besorgt um die Kunst des Erzählens, die er verschwinden sah; er war aber auch, wie er in Über den Begriff der Geschichte (1940/1942) darlegt, besorgt um das reale Verschwinden anderer Geschichten als derjenigen, die unsere tagesaktuelle Auffassung beherrschen, wobei er hier das Tatsächliche betont, das im Moment einer Gefahr aufblitzen müsse, um erkannt werden zu können.[39] Die Kunst des Erzählens und der Respekt vor dem Tatsächlichen verbinden sich bei ihm auf eindringliche Weise. Das Erzählen wird bei Benjamin, im Unterschied zum faktischen Bericht, zur Rettung des Tatsächlichen, das heißt der Sache. So schreibt er in dem Denkbild Kunst zu erzählen, einem weiteren der Reihe der Kleinen Kunst-Stücke:
Jeder Morgen unterrichtet uns über die Neuigkeiten des Erdkreises. Und doch sind wir an merkwürdigen Geschichten arm. Woher kommt das? Das kommt, weil keine Begebenheit uns mehr erreicht, die nicht schon mit Erklärungen durchsetzt ist. Mit anderen Worten: beinah nichts mehr, was geschieht, kommt der Erzählung, beinah alles der Information zugute. […] Die Information hat ihren Lohn mit dem Augenblick dahin, in dem sie neu war. Sie lebt nur in diesem Augenblick. Sie muß sich gänzlich an ihn ausliefern und ohne Zeit zu verlieren sich ihm erklären. Anders die Erzählung: sie verausgabt sich nicht. Sie bewahrt ihre Kraft gesammelt im Innern und ist nach langer Zeit der Entfaltung fähig.[40]
Was Benjamin an der ‚Geschichtenarmut‘ seiner Zeit sorgte – und vor dem Hintergrund der sich aktuell überschlagenden Meldungen zu den Amtshandlungen von Donald Trump und generell der Nachrichtenflut gewinnen diese Überlegungen neue Brisanz – ist, dass Erzählungen verstanden als Volksweisen, als Weisheiten des Volkes, die Übermittler von denjenigen Geschichten sind, oder mindestens sein können, die nicht Eingang in die offizielle Geschichtsschreibung gefunden haben; weil diese, wie er später in den Geschichtsthesen schreibt, stets die Geschichte aus der Sicht der Sieger erzählt, ja weil die offizielle Geschichtsschreibung sonst selbst noch die siegende Herrschaftsform ist.[41] Folglich ging es Benjamin gerade nicht um die Bewahrung des Bestehenden in einem kulturkonservativen Sinn, sondern um die Bewahrung von Hoffnungen in ihrem ganz profanen, nicht religiösen, dem Leben zugewandten Sinn:
Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf [Klassenkampf, S. A.] lebendig und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Sie werden immer von neuem jeden Sieg, der den Herrschenden jemals zugefallen ist, in Frage stellen.[42]
Zaatari bekam die Geschichte vom sich verweigernden Piloten schon als Kind erzählt, auch dass die Schule wenige Stunden später trotzdem bombardiert wurde – später erfuhr er, dass die Legende auf einer wahren Begebenheit beruht. Die eigentümliche Logik dieser Erzählung ist, dass die Tatsache der Bombardierung die Geschichte ihrer vorherigen Verweigerung nicht ungeschehen machen kann – oder, im übertragenen Sinn, in der weiteren Entfaltung des Themas von Letter to a Refusing Pilot: dass die Geräusche der nahenden Bomberstaffel, die er als Jugendlicher auf Tonbänder aufzeichnete, die Papierflieger nicht zum Absturz bringen, wohl aber problematisch konnotieren (Abb. 13, 14).[43] In dieser Art des Erzählens, für die Metaphern eine wichtige Form sind, weil sie gleichzeitig einen bewahrenden und einen aktualisierenden Moment beinhalten, werden Themen nicht alt – nicht, weil wir uns Bekanntes einfach wieder und wieder erzählen, sondern weil wir es vergegenwärtigen. Denn das meint, dass wir uns den Problemen des Übersetzens als einer Form des Tradierens stellen müssen, um uns im Benjamin’schen Sinn richtig zu ‚ernähren‘ – dazu hier nun seine Schlussfolgerung:
Dieses ist die neue „Theorie des Romans“. Sie reißt die Symbolintention des Einverleibens und damit ein Stück der anthropologischen Symbolintentionen aus dem Magischen, Hieratischen heraus und weist ihm Wirklichkeit im Profanen nach. Lesen ist Kommunion durch Essen im profanen Sinne. […] Der fundamentale Affekt des Lesers ist nicht die Spannung sondern der Hunger, Stoffhunger.[44]
Damit komme ich zum Schluss – zur profanen Magie metaphorischer Bildarbeit, die den Affekt, wie Mieke Bal es formuliert, als „kulturelle Kraft“ zu perspektivieren erlaubt[45], gerade weil die mit dem Affektbegriff theoretisierte Unterbrechung von Zeit und Wahrnehmung uns weniger als Ding an sich interessieren sollte[46], denn als Möglichkeitsraum für Veränderungen, die sich als solche nur in der Logik eines Vorher und Nachher bestimmen lassen.[47] In einem früheren, grundlegenden Text zur Metapher betont Bal die Notwendigkeit, in der Metapher nach der damit erzählten Geschichte, der Aussage, dem Satz im grammatischen Sinn zu fragen, d. h. nach dem damit vermittelten Akteur (dem Subjekt) und seinem Wirken (dem Verb).[48].
Zaataris metaphorische Figuren sind nicht besetzt – nicht durch ihn und nicht durch andere, vielmehr räumt er sie den Betrachtenden frei, indem er ihnen die Magie verleiht, der wir uns unterordnen – „I am subjected to its magic.“ Sie haben eine ebenso historisch konkrete wie ‚wahre Geschichte‘ (das Buch, das der Erzähler des Kleinen Prinzen in seiner Kindheit gelesen hatte) zu erzählen, an der Schnittstelle von ‚ich‘ und ‚wir‘, als Kommunion wie Benjamin sagt, d. h. als Bildung einer Gemeinschaft. Sie vermitteln sich als eine Erfahrung, die wir machen können, gerade weil wir sie nicht als Rohkost serviert bekommen, nicht selber machen mussten – wie Benjamin zu denken gibt:
Und dann ist dieser sehr wichtige Gesichtspunkt nicht zu vergessen: daß es unter unsern Lebensverhältnissen eben Vieles gibt, dem nur der Lesende gerecht werden kann […]. Man muß dabei davon ausgehen, wieviele wichtige matières premières, Urstoffe des Erlebens im Rohzustande ungenießbar sind und wie eben nicht, sie zu erleben sondern sie erzählt zu bekommen, ihren Nährwert und damit die Stärkung der Person zustande kommen läßt.[49]
Und so möchte ich meine Überlegungen zur Verschränkung von Erzählung und Erfahrung in der „echte[n], erfahrene[n] Metapher“ hier mit einer letzten ‚Kostprobe‘ schließen:
Was die Videoinstallation fordert, ist eine besondere Art des Sehens, visuell und imaginativ – als Nahrung für den Geist, eine Art des Gedankensehens, das den Körper mit einbezieht. Ich sehe es als kulturelle Praxis einer Kunst, über die Grenzen dessen hinaus, was die traditionelle Kunstgeschichte und die Philosophie erkennen können. Weit davon entfernt Ideen in sprachlicher Form zu diskutieren, breiten Videoinstallationen Ideen vor uns aus, damit wir sie sehen, damit wir uns mit ihnen als unser „ungedacht Gewusstes“ verbinden. Und währenddessen stellen sie uns in diese Gedankenbilder hinein. Zwischen privatem Traum und öffentlichem Raum ereignet sich das Bild. Bekannt, doch außerhalb unserer Gedanken, bricht das Bild, in welchem Medium oder welcher Form auch immer, zu einer Wanderung auf in den Bereich zwischen Individuum und Gemeinschaft, den wir, mangels eines besseren Wortes, „Kultur“ nennen. Dies ist auch ein Bereich, in dem Narrativität und Visualität keinen Gegensatz bilden.[50]
Bibliographie
Adorf, Sigrid (2007): „Nicht unmittelbar, sondern bedingt. Zum performativen Verhältnis von Subjekt und Bild am Beispiel einer Videoprojektion“. In: FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur 44, 14-22.
Adorf, Sigrid (2008): Operation Video. Eine Technik des Nahsehens und ihr spezifisches Subjekt: die Videokünstlerin der 1970er Jahre. Bielefeld: Transcript.
Adorf, Sigrid (2013): „Das Re-Zitieren von Träumen und seine Flimmeraffekte oder wie Elodie Pongs Videoarbeiten mich zum Mitsprechen veranlassen“. In: Elke Bippus u. a. (Hg.): Ästhetik der Existenz. Lebensformen im Widerstreit. Zürich: Edition Voldemeer, 151-172.
Adorf, Sigrid/Christadler, Maike (2014): „New Politics of Looking? – Affekt und Repräsentation. Einleitung“. In: FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur 55, 4-15.
Angerer, Marie-Luise (2007): Vom Begehren nach dem Affekt. Zürich/Berlin: Diaphanes.
Avanessian, Armen, Hg. (2013): Realismus Jetzt. Spekulative Philosophie und Metaphysik für das 21. Jahrhundert. Berlin: Merve Verlag.
Bal, Mieke (2002): Kulturanalyse. Übers. v. Joachim Schulte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Bal, Mieke (2004): „Eine Bühne schaffen: das Thema Mise-en-Scène“. Übers. v. Pauline Cumbers u. Otmar Lichtenwörther. In: Peter Pakesch (Hg.): Video-dreams. Zwischen Cinematischem und Theatralischem. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 28-49.
Bal, Mieke (2006): „Einleitung: Affekt als kulturelle Kraft“. Übers. v. Antje Krause-Wahl. In: Antje Krause-Wahl u. a. (Hg.): Affekte. Analysen ästhetisch-medialer Prozesse. Bielefeld: Transcript, 7-19.
Bal, Mieke (2010): Of what one cannot speak. Doris Salcedo’s political art. Chicago/London: University of Chicago Press.
Benjamin, Walter (1980): Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Derrida, Jacques (1998): „Der Entzug der Metapher“. Übers. v. Alexander G. Düttmann u. Iris Radisch. In: Anselm Haverkamp (Hg.): Die paradoxe Metapher. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 197-234. Frz. Orig.: „Le retrait de la métaphore“. Vortrag von 1978, publiziert in: ders.: Psyché. Inventions de l’autre. Paris:
Galilée, 1987, 63-94.
Everts, Lotte u. a., Hg. (2015a): Kunst und Wirklichkeit heute. Affirmation – Kritik – Transformation. Bielefeld: Transcript.
Everts, Lotte (2015b): „‚What does one see then?‘ Perspektivwechsel mit Eija-Liisa Ahtila“. In: dies. (2015a), 65-91.
Fahlenbrach, Kathrin (2010): Audiovisuelle Metaphern. Zur Körper- und Affekt-ästhetik in Film und Fernsehen. Marburg: Schüren (= Marburger Schriften zur Medienforschung 15).
Hoppe-Sailer, Richard (2015): „Die Künste und die Wissenschaften. Beobachtungen anlässlich der dOCUMENTA (13)“. In: Everts (2015a), 111-124.
Kravagna, Christian (2000): „Politische Künste, ästhetische Politiken und eine kleine Geschichte zur Nachträglichkeit von Erfahrung“. In: Roger Buergel/Ruth Noack (Hg.): Dinge, die wir nicht verstehen. Wien: Generali, 23-31.
Marchesoni, Stefano (2013): Walter Benjamins Konzept des Eingedenkens. Über Genese, Stellung und Bedeutung eines ungebräuchlichen Begriffs in Benjamins Schriften. Dissertation. Università degli Studi di Trento/Technische Universität Berlin.
Saint-Exupéry, Antoine de (1943): Der kleine Prinz. http://www.derkleineprinz-online.de/text/1-kapitel/ (zuletzt gesehen: 15. 2. 2017). Frz. Orig.: Le Petit Prince. New York: Reynal & Hitchcock, 1943.
Silverman, Kaja (1999): „Politische Ekstase“. In: Ludwig Nagl (Hg.): Filmästhetik. Wien: R. Oldenbourg Verlag/Akademie Verlag, 140-175 (= Wiener Reihe.
Themen der Philosophie Bd. 10.).
Simblist, Noah (2016): „Two Point Perspective (Part I-III)“. In: Tohu. http://tohumagazine.com/publication-types/essay (zuletzt gesehen: 15. 2. 2017).
Strutynski, Peter (2017): „Wir verweigern Angriffe in den besetzten Gebieten“. In: AG Friedensforschung. http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Israel/verweigerer2.html (zuletzt gesehen: 15. 2. 2017).
Wilson-Goldie, Kaelen (2013): „Die Archäologie des Gerüchts. Akram Zaataris Brief an einen sich weigernden Piloten. Film- und Videoinstallation im Pavillon des Libanon, 55. Biennale Venedig 2013“. In: Nafas Kunstmagazin. http://u-in-u.com/de/nafas/articles/2013/akram-zaatari-venice/ (zuletzt
gesehen: 15. 2. 2017).
Zaatari, Akram (2012): A Conversation with an Imagined Israeli Filmmaker Named Avi Mograbi. Les Labora: Sternberg Press.
Zaatari, Akram (2013): Letter to a Refusing Pilot. HD Video (16:9), 34 min., Farbe, Stereo, entstanden für den libanesischen Pavillon der Biennale Venedig.
Fussnoten
1 Textauszug aus Zaatari (2013).
2 Vgl. Simblist (2016).
3 Der Titel ist auch als eine Hommage an Albert Camus’ Briefe an einen deutschen Freund zu lesen, vgl. Wilson-Goldie (2013).
4 Benjamin (1980), IV/2, 1013. Vgl. dazu auch IV/1, 436 und IV/2, 1012-1015.
5 Bal (2004), 41.
6 Vgl. Bal (2010), 31-73; zur Verwendung in Verbform (to metaphor) insbesondere 32 f.
7 Bal (2010), 51.
8 Vgl. Simblist (2016), Part II.
9 Vgl. Zaatari (2012), S. 30.
10 Zaatari (2012), 3.
11 Zaatari (2012), 3.
12 Zaatari (2012), 10.
13 Haggai Tamir gehört zu einer Gruppe von 27 Piloten der israelischen Luftwaffe, die sich 2003 gegen Luftangriffe aussprachen, welche zivile Opfer als Kollateralschaden in Kauf nehmen; vgl. Strutynski (2017).
14 Vgl. Simblist (2016), Part II.
15 Vgl. Fahlenbrach (2010).
16 Simblist (2016), Part II.
17 Vgl. Zaatari (2012), 3 f., 20 u. a.
18 Bal (2004), 29.
19 Vgl. dazu auch Adorf (2008), Adorf (2007) und Adorf (2013).
20 An dieser Stelle ließe sich, wie Bal es wiederholt in ihren Texten tut, an Silverman (1999) anknüpfen, die eben diese politische Dimension transgressiver ästhetischer Erfahrungen reflektiert.
21 Vgl. Bal (2006), 15.
22 Bal (2006).
23 Everts (2015a), 88.
24 Maurice Merleau-Ponty zit. nach Everts (2015b), 65.
25 Everts (2015a), 9.
26 Vgl. etwa die Documenta 13 von 2012, aber bezogen auf die genannte Kritik v. a. auch den sogenannten Spekulativen Realismus, vgl. Avanessian (2013).
27 Vgl. Hoppe-Sailer (2015), insbesondere 121-124.
28 Benjamin (1980), IV/2, 1012.
29 Benjamin (1980), IV/2, 1013.
30 Benjamin (1980), IV/2, 1014 und IV/1, 436.
31 Vgl. etwa Marchesoni (2013), 5 f.
32 Vgl. Marchesoni (2013), 5.
33 Benjamin (1980), IV/2, 1013.
34 Benjamin (1980), VII/1, 257.
35 Vgl. Derrida (1998), 197-200.
36 Benjamin (1980), IV/1, 435.
37 Saint-Exupéry (1943).
38 Textauszug aus Zaatari (2013).
39 Vgl. Benjamin (1980), I/2, 691-704, insbesondere V-VIII (695-697).
40 Benjamin (1980), IV/1, 436 f.
41 Benjamin (1980), I/2, 691-704, insbesondere These VI (695).
42 Benjamin (1980), I/2, 694.
43 Zu der Bedeutung poetischer Bilder im Kontext realpolitischer Bedrohungen und der politischen Dimension ästhetischer Erfahrungen vgl. auch Kravagna (2000).
44 Benjamin (1980), IV/2, 1013 f.
45 Vgl. Bal (2006).
46 Vgl. dazu Angerer (2007).
47 Vgl. Adorf/Christadler (2014).
48 Vgl. zur Metapher als „Mini-Erzählung“ Bal (2002), Kapitel 3, hier: 52.
49 Benjamin (1980), IV/2, 1013.
50 Bal (2004), 35.

Abb. 3 & 4: Akram Zaatari: Letter to a Refusing Pilot (2013). Video in der Ausstellung Akram Zaatari: This Day at Ten, Kunsthaus Zürich, 20. 5. – 31. 7. 2016, kuratiert von Mirjam Varadinis. Fotos: Sigrid Adorf.

Abb. 5-8: Akram Zaatari: Letter to a Refusing Pilot (2013). Video und Details der Hängung in der Ausstellung Akram Zaatari: This Day at Ten, Kunsthaus Zürich, 20. 5. – 31. 7. 2016, kuratiert von Mirjam Varadinis. Fotos: Sigrid Adorf.

Abb. 10: Akram Zaatari: Letter to a Refusing Pilot (2013). Video in der Ausstellung Akram Zaatari: This Day at Ten, Kunsthaus Zürich, 20. 5. – 31. 7. 2016, kuratiert von Mirjam Varadinis. Foto: Sigrid Adorf.