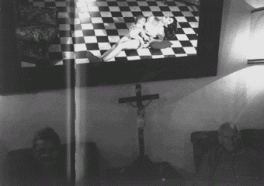Verkitschte Vanitas
Das Fehlgehen der „Devotio postmoderna“
Indem (...) das wirkliche Subjekt die Erscheinung Gottes ist, gewinnt die Kunst jetzt erst das höhere Recht, die menschliche Gestalt und Weise der Äusserlichkeit überhaupt zum Ausdruck des Absoluten zu verwenden, obschon die neue Aufgabe der Kunst nur darin bestehen kann, in dieser Gestalt nicht die Versenkung des Inneren in die äußere Leiblichkeit, sondern umgekehrt die Zurücknahme des Inneren in sich, das geistige Bewußtsein Gottes im Subjekt zur Anschauung zu bringen.(G.W.F. Hegel, Ästhetik)
Le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas.(Jean Paul Gaultier, Interview)
Die rätselhafte Wiederkehr religiöser Bilder ist ein breites Phänomen der Subkulturen, an denen Mode und Pop partizipieren. Letztes Indiz: Das Designerlabel, das bei den diesjährigen Modenshows in New York das größte Aufsehen erregte, heißt Imitation of Christ und zeigte seine Kollektion in einem Beerdigungsinstitut. Was zitiert wird, ist eine Stufe populärer Kunst vor dem Medienzeitalter. Besonders beliebt sind die Ikonen der populären Devotion des 19. Jahrhunderts: das Kruzifix selbst, Notre Dame de Lourdes, das Herz Jesu und das Portrait der 1998 zum Kirchenlehrer erklärten Heiligen des kleinen Weges, Thérèse de Lisieux. Die Dolce & Gabbana-Kollektion 1999 stand im Zeichen des Herzen Jesu. Jean Paul Gaultier inszenierte südamerikanische Märtyrerverehrung im Stil Frieda Kahlos; beherrschend neben dem Kreuz auch hier das Herz Jesu. Der wahrscheinlich erfolgreichste Popstar der 90er Jahre heißt Madonna, bringt eine CD unter dem Label Immaculate Collection heraus, läßt Statuen in ihren Video-Clips heiße Tränen weinen und nennt ihr nennt ihr erstes Kind, das „größte Wunder ihres Lebens“, nach dem Ort der berühmtesten Marienerscheinung des 19. Jahrhunderts, Lourdes. Dem offiziellen Portrait der Thérèse de Lisieux kommt es zu, Viva Maria-Unterwäsche zu bebildern.
Was hat es mit dieser Erscheinung des Göttlichen im Mundan-Mondänsten auf sich? Das Wiederauftauchen religiöser Motive im Stil des 19. Jahrhunderts in Mode und Pop ist nicht so beliebig, wie es die für solche Phänomene entwickelte Kategorie, die des Trash, suggeriert. Es ist nicht so, daß sich die Mode aus dem weiten Fundus des Möglichen nun auch diese Motive beliebig aneignete. Das Dreieck von Religion, Kunst und Mode ist bereits Teil der populären religiösen Kunst; die religiöse Kunst des 19. Jahrhunderts war die erste pop art. Es ist der modische Aspekt dieser Bilder schon im 19. Jahrhundert, der die Madonna von Lourdes heute so friseursalongeeignet, das Herz Jesu so clubkompatibel und die sieben Schwerter der Schmerzensmadonna so disco-outfit-fähig macht. Dank des Saint-Sulpice-Styling, das das pausbäckige normannische Mädchen Thérèse in eine „jolie chose en sucre“ verwandelt hat, wie Jean Rouaud [1] sagt, ist das Bild der kleinen Heiligen aus Lisieux mit den Rosen erst für die Weltkriege und dann für Unterwäsche verwendbar geworden.
Dem Versuch, das Göttliche im Menschlichen zur Erscheinung zu bringen, haftet seit dem 19. Jahrhundert in der religiösen Kunst etwas Kitschiges an; das fanden bereits Zeitgenossen wie der nicht eben zimperliche Zola, dem es ob der Geschmacklosigkeit der Devotionalien in Lourdes fast die Sprache verschlug. Rouauds Roman hat die ambivalente Beziehung volkstümlicher Frömmigkeit zum Phänomen Mode besonders pointiert analysiert. Der Ich-Erzähler der Champs d’honneur beschreibt die Standard-Andachtsecke seiner Tante Marie mit Kruzifix, Herz Jesu, Notre Dame de Lourdes und Thérèse de Lisieux und arbeitet deren Affiziertheit durch Mode hervor, die penetrant zugerichteten Körper im Vordergrund. Die Herrichtung des Fleisches macht es unmöglich, auf das durchsichtig zu werden, was in ihm aufscheinen sollte: das Göttliche in menschlicher Gestalt. Sie stößt den Betrachter auf nichts als die eigene, hergerichtete Materialität und versperrt sich jeder Transzendenz. Dank der historistischen, höfischen Louis Treize-Stilisierung, die Jesus zu einem cross dresser mit gepudertem Teint und Locken macht, wird auch von seinem Leiden nichts mehr sichtbar. Es ist die schiere Anatomie der Herzkammern, ihre längliche Ausdehnung, die die Ewigkeit der Passion illustrieren soll:
Unser Herr öffnet sein Gewand mit der schamhaften Kühnheit eines jungen Mädchens, das seinen Busen zeigt, und weist uns das Kreuz zwischen den Herzkammern, die das Leiden der Passion ewig verlängern. Sein gepuderter Teint und seine Frisur im Louis Treize-Stil rücken den schwarzen Freitag in weite Ferne.[2] Der Karfreitag, vendredi saint, wird zum prosaischen Tag des Börsencrash, vendredi noir. Die prekäre Lage tritt am klarsten in Rouauds Beschreibung der nach den Anweisungen des Hirtenmädchens Bernadette angefertigten und seitdem zu den Weltikonen gehörenden Statue der Immaculata von Lourdes zutage. Sie hängt an einem modischen Körper, am Körper der Mode, kurz, am Körper des Mannequins.
Eine Madonna, so elegant wie ein Mannequin der haute couture, die Taille von einem blauen Seidenschal unterstrichen, dessen Bänder die Linie der Schenkel schmiegend nachzeichnen. (...) Denn trotz ihrer luftigen Erscheinung verbirgt diese Unbefleckte Empfängnis unter ihrer Tunica einen Körper, voll der Gnade, voller Anmut. (...) Wunder der Fleischwerdung. Das ist ihr Leib.[3]
Im „plein de grâce“ zitiert der Text das gratia plena des Engels der Verkündigung und im „ceci est son corps“ die Einsetzungsworte des Meßopfers: „das ist mein Leib.“ Fleischwerdung und Transsubstantiation, die beiden entscheidenden Glaubenssätze, deren Thema das Erscheinen des Göttlichen im Menschlichen ist, werden bei Rouaud in der buchstäblichen Auffassung des 19. Jahrhunderts thematisch. Sie verweisen nicht mehr auf eine überirdische Transzendenz, die sich auf Erden sinnlich-körperlich manifestiert, sondern auf die fleischliche Schönheit eines ebenso anmutigen wie gnadenleeren Körpers ganz von dieser Welt. Der Madonnenkörper, Inbegriff des in den Himmel erhobenen vergeistigten Körpers, in dem sich die Fleischwerdung des Wortes ereignete, erscheint als ein um jede Transzendenz gekappter so geistwie seelenloser Körper: als Körper eines „mannequin de haute couture“, eines Puppenkörpers, der, in Bewegung gesetzt und verlebendigt, Kleider vorführt.
Die Repräsentation von Körpern in der Moderne hängt am Körper des Mannequins. Sie nimmt am Puppenkörper, wie er für die Herstellung der nicht mehr maßgeschneiderten Mode des prêt-à-porter gebraucht wurde, Maß. Das Mannequin ist nicht nur Resultat der Abstraktion und Normierung individueller Körper; es ist auch eine Reduktion der Maße der Statue, die in ihrer Vollkommenheit eine göttliche Schönheit spiegelte. Die Faszination des Puppenkörpers besteht in seiner Seelenlosigkeit. Der Körper des Mannequins belebt, setzt ein Artefakt in Bewegung, inkarniert den leblosen Körper einer Puppe. Spiegelt die Vollkommenheit der Statue den Abglanz des Göttlichen, so verdankt sich die Vollkommenheit des Mannequinkörpers einer seelenlosen Belebung, der Verlebendigung des äußerlich-mechanisch Normierten. Insofern ist das Mannequin ein Zerrbild der Statue. Verweist die eine auf das Ansichtigwerden des Göttlichen in den himmlischen Maßen des Menschlichen, so das Mannequin immer nur auf den toten Körper der Puppe. Hängt die Schönheit der einen am Erscheinen des Göttlichen, dann die Faszination des Mannequins an seelenloser Äußerlichkeit.
An diesem, für das Problem der Repräsentation in der Moderne entscheidenden Punkt liegt Bettina Rheims’ und Serge Bramlys INRI, nach Pasolinis Evangelium des Matthäus die erste Inszenierung der Passion, auf der Höhe der Zeit. [4] Die Darstellung der Passion im Medium von Photographie und Text wurde vom französischen Staat gesponsert, der trotz seiner zur Schau getragenen Laizität die christlich-abendländische Tradition nicht sangund klanglos verschwinden lassen wollte. Es erschien simultan in französischer, englischer und deutscher Ausgabe und war von vornherein höchst umstritten. „Zweitausend Jahre danach“ bringt INRI die Geschichte der abendländischen Darstellungspolitiken an der Matrix aller Darstellungen auf den Punkt: am Leben und Sterben Christi.
Bramly und Rheims beziehen sich in ihrem Vorwort auf das zweite Konzil zu Nicea im Jahre 787, das den Ikonoklasmus beendete und die Abbildbarkeit des Menschen festschrieb. Denn Gott ist Mensch geworden und insofern ist jeder Mensch ein Bild der Erlösers, das von nun an abgebildet werden darf und soll. Bramly knüpft an die Abbildfähigkeit der Menschwerdung den Ursprung aller heiligen wie auch profanen Kunst. Alle abendländische Darstellung – in Hegels Begriffen alle „romantische Kunst“ – stellt das menschwerdende Aufscheinen des Göttlichen dar, zeichnet es im Menschen als seiner Erscheinungsgestalt nach. Als Gottes Ebenbild geschaffen, war diese Ebenbildlichkeit im Sündenfall entstellt und erst durch die Fleischwerdung und ihre Vollendung in der Passion des Erlösers wiedergewonnen worden.
Serge Bramlys und Bettina Rheims’ Unternehmen übersetzt das Leben Christi, des Musters aller Darstellbarkeit über die Zeiten, in unsere Zeit. Mit dieser Übertragung tun sie ihrem Selbstverständnis zufolge nichts anderes als die Künstler der Renaissance, die Leben und Leiden des Herrn umstandslos in die Vororte von Florenz verlegen und die Protagonisten nach der Mode der Zeit kleiden konnten.
Der Konrad-Witz-Nachfolger stellt eine Pietà vor die zeitgenössische flamboyant-gothische Architektur von Basel, und Bellini malt seine Madonnen mit der gleichen Selbstverständlichkeit vor dem Hintergrund der oberitalienischen Renaissancestädte. Es ist jedoch naiv anzunehmen, Übertragung sei gleich Übertragung, ein Medium wie das andere, und Ästhetik hätte keine geschichtliche Formation, die selbst Geschichte hat und macht. Im Medium der Photographie, dargestellt von professionellen Models, welche die Darstellung des Menschen im späten 20. Jahrhunderts in ihrem Modekosmos prägen, kommt in der zeitgenössischen Passion, die Bettina Rheims photographiert, etwas anderes zur Anschauung als in der Übertragung der Passion in die Zeit der Renaissance, ein Bruch nämlich der Übertragung und mit der Übertragung.
Die Frage ist natürlich, was mit der Erzählung und der bildlichen Darstellung von Christi Leben und Sterben zu diesem Zeitpunkt, heute, erreicht werden soll. Traditionellerweise reichte die Darstellung des Herrn von Ikonen über Andachtsbilder bis zur sogenannten Bibel der Armen, die nicht durch das Wort, sondern durch Bilder lehrt. Für Hegels Ästhetik wird diese Verbildlichungshilfe ad recte credendum zur Darstellungsfunktion der romantischen Kunst schlechthin, einer Kunstform, deren wahrer Inhalt „die absolute Innerlichkeit“, und deren „entsprechende Form die geistige Subjektivität“ sein soll. In INRI erreicht diese Darstellungsform ihr Ende in der Modephotographie. Mit dem Inbegriff des seelenlosen Körpers, dem Körper von Mannequins, haben Rheims und Bramly im Inbegriff seelenloser Kunst, deren Blick ein toter ist, ins Bild der Darstellung gesetzt, was für Hegel Inbegriff romantischer Kunst sein sollte. Man muß sich das im Anhang des Bandes, der nicht nur ein wissenschaftlich durchdachtes Sekundärliteraturverzeichnis (nur in der amerikanischen Ausgabe) mitführt, sondern das ganze imponierende Netz der Mode-Agenturen ausbreitet, vor Augen führen: die von den besten der einschlägigen Agenturen angeheuerten Modelle, die von einem der interessantesten der Designer, Jean Colonna, zurechtgemacht und mit Kleidern und Accessoires aus dem who is who der Modewelt ausgestattet sind. Von der Avantgardistin Anne Demeulemeester bis zum Fetischdesigner aller Schuhliebhaber, Manolo Blanik, ist alles versammelt, was man sich ausdenken könnte: Topolino, der zaubern konnte, hat die Modelle geschminkt, Clovis hat sie frisiert, so daß man tatsächlich im Aufgebot des Modekosmos die kosmische Qualität des zur Darstellung gebrachten Ereignisses erreicht finden kann.
Das garantiert nicht nur der Name der Photographin, die als Schöpferin moderner Ikonen seit Femmes fatales und Chambre close selbst zu einer Ikone geworden ist. Im Stern-Portfolio Femmes fatales erfahren wir und sehen wir in anderer Pose Athena Currey, die in INRI als Salome auftritt, und auch die Frau, die – unklassische Transposition – an Christi statt am Kreuz hängt. Provozieren gewohntermaßen die Photos von Rheims bis zum Skandal, so gehört der Stein des Anstoßes, die Inszenierung der aus diesen Skandalen identifizierbaren Mannequinkörper, zur Darstellungslogik des Kreuzigungsskandals selbst und der an ihm entzündeten Imitatio Christi. Aber anders als die Urszene der Darstellung, die INRI reinszeniert, beweisen die Modells nicht die Liebe des Gekreuzigten, sondern nichts als die Spuren der blanken, ihrer, wie seiner, körperlichen Zugerichtetheit.
Die artistische Kunst der Herrichtung wird auf den Photos nicht naturalisierend verborgen, sondern mit-dargestellt, zur Schau gestellt: Mannequins treten als Mannequins auf und erweisen die Zuständigkeit der Mode, wenn es um die angemessene Rücksicht auf Darstellbarkeit geht: Als zurechtgemachte schöne Kunstprodukte streichen sie ihre Modellqualität zur Feier der Darstellung in ihrer entscheidenden Stunde heraus, der Passion. Rheims’ Photos zeigen den typisch abwesenden Modellblick und die typischen Mannequinposen. In vielen erkennen wir fashion shots wieder. Die Vermischung der religiösen und der mondänen Sphäre ist bewußt angelegt und durchgehalten; sie offenbart in der Mischung den Ursprung der Darstellbarkeit aus dem Leiden des Menschgewordenen.
INRI ist, so meine These, Kommentar und vorläufiger Endpunkt einer Kunst, die auf Darstellung des Aufscheinens des Göttlichen im Menschlichen beruht. Während die klassische Kunst ideale Schönheit zeigt, „welche die äußere Anschauung über die Zeitlichkeit und die Spuren der Vergänglichkeit weghebt, um die blühende Schönheit der Existenz an die Stelle ihrer sonstigen verkümmerten Erscheinung zu setzen“ [5], und in der der Geist im Sinnlichen aufgeht, weiß der Geist auf der Stufe der romantischen Kunst,
daß seine Wahrheit nicht darin besteht, sich in die Leiblichkeit zu versenken; im Gegenteil, er wird sich seiner Wahrheit nur dadurch gewiß, daß er sich aus dem Äußeren in seine Innigkeit mit sich zurückführt und die äußere Realität als ein ihm nicht adäquates Dasein setzt. [6]
Damit ist das Äußere „als ein gleichgültiges Element anzusehen, zu dem der Geist kein letztes Zutrauen und in welchem er kein Bleiben hat.“ [7] Um es mit Hegel noch einmal anders zu formulieren:
Die griechische Schönheit zeigt das Innere der geistigen Individualität ganz in deren leiblicher Gestalt, Handlungen und Begebnisse hineingebildet, im Äußeren ganz ausgedrückt und selig darin lebend. Für die romantische Schönheit hingegen ist es schlechthin notwendig, daß die Seele, obschon sie im Äußerlichen erscheint, zugleich zeige, aus dieser Leiblichkeit in sich zurückgeführt zu sein und in sich selber zu leben. Das Leibliche kann deshalb auf dieser Stufe die Innerlichkeit des Geistes nur ausdrücken, insofern es zur Erscheinung bringt, die Seele habe nicht in dieser realen Existenz, sondern in ihr selbst ihre kongruente Wirklichkeit. Aus diesem Grunde wird die Schönheit jetzt nicht mehr die Idealisierung der objektiven Gestalt betreffen, sondern die innerliche Gestalt der Seele in sich selbst. [8]
Diese Innerlichkeit kann in der romantischen Kunst nicht mehr mit dem Äußeren verschmelzen, wie Hegel das für die antike Kunst postuliert, sondern gerade durch Loslösen von seinem endlich individuell Subjektiven, durch das Abtun der Nichtigkeit in Tod und Schmerz kommt der Geist zu sich, zur „Befriedung, Seligkeit und zu jenem versöhnten affirmativen Dasein“. [9] In der romantischen Kunst, um es paradox zu formulieren, scheint diese Innigkeit als objektive Wahrheit der sinnlichen Erscheinung zum Trotz, nur durch ihre Nichtung gewissermaßen, auf. Rheims’ Photographien zeigen das Restprodukt dieses Prozesses, sein negatives Anderes, das, was er zurückläßt; nicht als die Nichtigkeit der sinnlichen Erscheinung, nichts als eine hergerichtete Hülle, Zerrbild idealer Schönheit, sondern von jeder Innnerlichkeit so seelenwie geistlos entleert.
Was bleibt, zeigt INRI, ist nicht die Philosophie, sondern die Kunst in ihrer ganzen, unerhörten Kunst, einer Künstlichkeit, die in ihrer vertrackten Schönheit die verflossene Sehnsucht nach Transzendenz in der schönen Sperrung gegen alle Tranzendenz „aufhebt“ (Hegels Wort in Gottes Ohr), nicht dem Gott Mensch, sondern der Puppe Mannequin. Das macht die Mode zur vorherrschenden Kunst nach Hegels Ende der Kunst.
Allerdings liegt diese Konsequenz, und zwar auf symptomatische Weise, nicht in Serge Bramlys Kommentar, sondern allein in den Photographien von Bettina Rheims. Bramlys Text, der die epochale Vorgabe des Konzils von Nicea zitiert, die auch Hegels Begriff der romantischen Kunst zugrundeliegt, hält sich in dem von Hegel diagnostizierten Rahmen. Bramly zufolge ist das Unternehmen INRI ganz damit beschäftigt, die alte theologische Grundlage auf einen neuen medialen Stand zu bringen und Ikonen mit den Mitteln der Photographie zu produzieren. Als Vorbild dieser neuen, zeitgerechten Ikonizität gilt ihm ein in Beton gegossener Christus auf einem Warschauer Parkplatz, der als Hochspannungsmast dient und von Isolatoren wie mit einer Dornenkrone bekränzt wird. Sein verwittertes Antlitz ist von Rostspuren überzogen: Von keinem Künstler seien je die von Christus vergossenen Bluttränen am Kreuz so ergreifend dargestellt worden, schreibt Bramly. Dieses Beispiel läßt sich restlos in die Hegelschen Kriterien romantischer Kunst zurückübersetzen. Noch die häßlichste, kälteste, unbeseelteste, tatsächlich standardisiert präfabrizierte Innerlichkeit, die durch das Materielle der Darstellung hindurchleuchtet, selbst diese vergeistigt und „ergreift“ den Betrachter. Seelenvoll zeigt dieser Christus in seinem Leiden in völliger Nichtung seiner leiblichen Hülle seine Liebe. Es ist bezeichnend, daß dieses Ergreifen nicht mehr einer künstlerischen Intention zu danken ist – das wäre dann tatsächlich Kitsch –, sondern dem häßlichen, technischen Zufall und den ganz willkürlichen Spuren der Zeit.
Das Programm von Rheims’ Photographie läuft dieser romantischen Kunst präzise zuwider. In ihren Photos wird nicht eine Materie dargestellt, die trotz ihres völligen Mangels an Idealität von Geist durchdrungen wäre, sondern ein künstlich zurechtgemachtes, vollkommen hergerichtetes, rein im Materiellen liegendes Ideal herangezogen, das gezeichnet ist von der Abwesenheit des Geistes und durch diese ostentative Abwesenheit nicht ergreift – es war die der romantischen Kunst gemäße Haltung –, sondern fasziniert. Ein krasseres Auseinanderfallen von Inhalt und Form ist nicht vorstellbar. Der Gegenstand der romantischen Kunst wird mit ostentativ unromantischen Mitteln inszeniert. Statt erleuchteter Bilder bekommen wir so perfekt wie möglich ausgeleuchtete Photos, aus denen eines nicht hervorleuchtet: seelenvolle Innerlichkeit. Was auf diesen Bildern des Lebens und Sterbens des Herrn erscheint, ist die stilisierte körperliche Oberfläche als dessen säkulares Legat, das in der kompletten Blockade gegen jede Verklärung verharrt und jedes Erscheinen des Übersinnlichen im Sinnlichen dementiert.
Hinter dem photographischen Schein scheint nichts hervor. Er glänzt leer in sich selbst, eine geschmückte Vanitas, deren überirdischer Jenseitsverweis in diesseitiger Ästhetisierung verendet. Dies geschieht allerdings nicht, wie im Kitsch der populären Kunst des 19. Jahrhunderts, unreflektiert, sondern wird im Gegenteil in diesen Bildern ostentativ hervorgekehrt. INRI bringt die Epoche der romantischen Kunst ebenso nachdrücklich wie leichten Herzens zu Ende. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Photos und nicht der Text einen Skandal verursacht haben und auf vehemente Abwehr gestoßen sind. Auch wo diese sich inhaltlich festmacht, am nackten Körper der gekreuzigten Frau, liegt das Skandalon tiefer, in der Logik der Darstellung, die den Blick in die schöne Blöße des Mannequinkörpers bannt.
Bramly ist nicht Rouaud. Dem Duktus der Evangelien angeschmiegt, sieht sich sein Text in der theologischen Pointierung so getreu illustriert, wie er auf ästhetischer Ebene dementiert wird: Auf der thematischen Ebene bleibt im Bild, wenn auch modernisiert und aktualisiert, wovon der Text, der biblische wie der Bramlys, erzählt. Bramly folgt anti-paulinischer Theologie; er stellt das Christentum als Vollendung des Judentums dar und arbeitet gegen die paulinische Zweiteilung vom jüdischen Buchstaben, der tötet, und dem durch Christus in die Welt gebrachten Geist, der belebt. Das heißt, INRI besteht auf der buchstäblichen Erfüllung der Schrift, und die Sinnlichkeit des jüdischen Buchstabens wird wie im Text in mehreren Photos gezeigt. Der Körper des Christusknaben ist mit hebräischen Schriftzeichen übersät; als Chassidimkind angezogen, verleibt er sich die Buchstaben der Schrift in Form von Baitwateln ein. In ähnlich emblematischer Weise akzentuiert Bramly photographische Szenen in theologisch aktualisierender Absicht. Gegen die notorische paulinische Frauenfeindlichkeit betont er die in neueren Forschungen, exemplarisch die von Elaine Pagels an apokryphen Evangelien aufgewiesene Rolle der Frauen in der frühen Kirche.
Zentral im Amalgam der buchstäblich historisierenden, jüdisch-urchristlichen Kontextualisierung ist die Rolle Mariens als Miterlöserin; INRI zeigt sie in der Parallel-Erscheinung der Jungfrau und des verklärten Jesus, die sich in der parallelen Darstellung beider Himmelfahrten wiederholt, und greift darin gegenreformatorische Ikonographie auf. Keineswegs auf die eine Schrift fixiert, beläßt es Bramly nicht bei der strengen Paraphrase, sondern bezieht alle Arten von Traditionsbelegen ein: Liturgie, (Ave Maris Stella, Agnus Dei), Kirchenväter und die Tradition (Fortunatus, Dante, Johannes vom Kreuz oder Bossuet). Die einzige nennenswerte theologische Pointe dieses Panoramas ist ein Motiv der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts; sie kommentiert das photographische Triptychon der Kreuzigung in der Mitte des Buchs und macht geltend, daß mit Christus die ganze Menschheit ans Kreuz geschlagen wird (so die Unterschrift unter der Kreuzigungsszene). Die spiegelbildlichen Versionen der Mitgekreuzigten, einer jungen Frau wie eines jungen Mannes, sind Ausdruck der geschlechterpolitischen Verallgemeinerung; das letzte Bild des von Stacheldraht gekrönten und arabesk bemalten jungen Mannes, der über der Brust den Anschluß für elektrische Folter trägt, bringt die Aussage des Motivs in die aktuellste, allgemeinste Gestalt: Die Imitatio Christi wird zum objektivsten Ausdruck des Leidens der Menschheit. Soweit kooperieren Text und Bild in der pastoralen Bestimmung, der die Darstellung traditionell unterlag.
Aber INRI ist in seinem Bildteil ein gedrängter synkretistischer Kommentar der Darstellungsstile der westlichen Kunst in ihrer Abhängigkeit vom christlichen master plot der Kreuzigung. [10] Bettina Rheims’ virtuose Anspielungskunst ist allgegenwärtig und versatil: Bellini und Mantegna, holländisches Stilleben und Intérieur, Salpêtrière und Magritte, von den subtileren zeitgenössischen Verweisen auf die Illustrierten, unter denen Rheims selbst der Stern maßgeblich geprägt hat, ganz zu schweigen von Brigitte, Bunte, Paris Match und Vogue. Diese Geschichte der Darstellung tritt bei Rheims radikaler, als Hegel absehen konnte, im Verfall auf: als eine gescheiterte zu Tage. Statt das überlieferte Heilsgeschehen auf den göttlichen Abdruck hin durchsichtig zu machen, offenbart die Photographie, seit Bazin und Barthes eben erst mit dieser Herkunft des göttlichen Abdrucks betraut, deren totale Intransparenz, bezeugt sie den Rückschlag der Jenseitigkeit in eine Welt, deren Schicksal schöne unerlöste Vanitas bleibt. Deren Name und Kunstform ist Mode, durch styling gerüstete, unhintergehbare Leiblichkeit.
Nichts bleibt von der Alternative der alten vanitas, die als blendende und glänzende, ihre Todesverfallenheit in nichtigem, weltlichem Tand überspielende Eitelkeit zugunsten einer wahreren, ewigen Liebe oder unveränderlichen, göttlichen Wahrheit zurückzulassen. Das war die Botschaft des klassischen Zeitalters der vanitas, des Barock, das im Ausstellen und Schmücken des Verfalls einen Vorgeschmack von Ewigkeit im flirrenden Glänzen von Gold, Edelsteinen und Seide zu erzeugen und den Übersprung in die Übersinnlichkeit zu erzwingen suchte, in Benjamins „Überspannung der Transzendenz“. Dieser Übersprung ist der Mode nicht gegeben; nach Benjamin wäre dieses Manko so etwas wie ihre historische Definition. Die Überspannung fällt vielmehr in sich zurück, schlägt sich nieder in der Schönheit der geschmückten Puppe, keiner Leiche mehr, die in barockem Überschwang ihre Auferstehung erzwänge, sondern ein vollkommen hergerichteter Körper, an dem nichts aufscheint als eine blendende, seelenlose Äußerlichkeit. Um das Licht aller wahren Schönheit gebracht, ist alles, was uns bleibt, nur die blendende vanitas zu schmücken. Die geschmückte vanitas ist unsere einzige Wahrheit und folgerichtig das Schlußemblem von INRI: ein Totenkopf vor dunkelblauem Himmel, mit erikafarbenen Rosenblättern verziert, von Disteln wie mit einer Dornenkrone bekränzt, auf einem vom Meer ausgebleichten und verwaschenen Stück Treibholz. Trotz aller Ähnlichkeit mit den mit Seide und Perlen bestickten, mit Edelsteinen besetzten, kostbar verzierten Totenschädeln des Barock, wie sie in der Pariser Ausstellung La mort n’en saura rien zu bewundern waren, liegen Welten zwischen diesen beiden Schädelstätten: die eine sucht durch lebenslange Versenkung in den Tod ein Leben zu erzwingen, die andere nimmt im Tod fast heiter die Vergänglichkeit des Irdischen hin und schmückt sie, vergänglich wie sie ist, mit der Schönheit der Natur.
Beispiele, Szenen
Was läßt sich, wenn das so richtig ist, aus INRI für den Begriff einer nach-hegelschen (postchristlichen und postromantischen) Kunst lernen? In seiner Ästhetik setzte Hegel die romantische von der klassischen Kunst ab, die er definierte durch „die schöne Erscheinung des Geistes in seiner unmittelbaren (...) sinnlichen Gestalt.“ [11] Auf der Stufe der romantischen, christlichen Kunst hingegen
weiß der Geist, daß seine Wahrheit nicht darin besteht, sich in die Leiblichkeit zu versenken; im Gegenteil, er wird sich seiner Wahrheit nur dadurch gewiß, daß er sich aus dem Äußeren in seine Innigkeit mit sich zurückführt und die äußere Realität als ein ihm nicht adäquates Dasein setzt. [12]
Was die Photographien von Rheims über Hegel hinaus versperren, ist die Rückkehr „aus dem Äußeren in seine Innigkeit“; und was sie uns lassen, ist die preisgegebene Äußerlichkeit, die vollkommen zugerichtete Larve verlorener Innigkeit, als einziges, inadäquates, aber in der Vielgestalt der äußeren Oberfläche faszinierendes Sein.
Hegel wies, um den Unterschied zwischen klassischer und romantischer Kunst zu belegen, auf die Blicklosigkeit der klassischen Statuen hin. Geht den „Skulpturgestalten der Ausdruck der einfachen Seele, das Licht des Auges“ [13] ab, so erscheint „der Gott der romantischen Kunst (...) sehend, sich wissend, innerlich subjektiv und sein Inneres dem Inneren aufschließend.“ [14] Der antrainierte, typisch blicklose Blick der Modelle, die Rheims’ Passionsbildern Gestalt leiht, beweist den völligen Mangel jeder Innerlichkeit, die Abwesenheit von Seele. Nun ist dieser leere, spiegelnde Blick, der kein Fenster zur Seele auftut, Signum und Faszinosum moderner Erotik. Rilke und Baudelaire verloren sich, gebannt, in solchen Blicken.
Die ideale Schönheit, die in der romantischen Kunst verschwunden war, da sie im Gegensatz zur klassischen Kunst Spuren der Zeit und individuelle Abweichungen nicht in einem überzeitlichen Ideal aufhebt, kehrt in dieser postromantischen oder postchristlichen Kunst wieder. Dieses neue Ideal aber zeigt nicht mehr wie das klassische das Eingehen des Geistes in ein vollkommen sinnlich Schönes. Es ist nicht mehr die „Seligkeit im Sinnlichen“, wie Hegel schön sagt, sondern leere Hülle, so schöne wie geistlose Larve, die Hohlform dessen, was der Körper in der romantischen oder der christlichen Kunst sein sollte: Gefäß für eine Anschauung von Innerlichkeit, die im Körperlichen nicht aufgeht, in den Körper nicht eingehen kann. Ist der Blick der klassischen Kunst einer des staunenden Genießens, so korrespondiert der der romantischen Kunst ein Blick der der Anteilnahme und Versenkung. Der postromantische Blick dagegen ist fetischistisch. Fasziniert versenkt er sich in äußerlich Seelenloses.
Es gibt Photos in INRI, in denen der romantische, anteilnehmende Blick ungehemmt vorherrscht. Es sind die Bilder des Leidens. INRI teilt sich in zwei Leidenszyklen: den Zyklus der Wunder, der Kranke zeigt, und den Kreuzweg der Passion. Das übermenschliche Leiden des Herrn läßt das Individuum auf diesen Photos gewissermaßen von aller Innerlichkeit leer, ganz in seiner geschundenen Hülle entäußert aufgehen und weckt so das Mitleid des Beschauers. Die Passion ist der Modus, in dem das Leid der Welt darstellbar geworden ist. Am klarsten geschieht das in den Szenen der Gefangennahme, der Auspeitschung und des Ecce homo. Alle drei Bilder evozieren Polizeibrutalität und die Foltermethoden südamerikanischer Diktaturen. Gelungen im Sinne romantischer Kunst, die Versenkung vermittelt und Anteilnahme weckt, sind diese Bilder nicht zuletzt, weil sie sich an Zitate aus der Geschichte der Malerei halten. Der tote Christus stellt Caravaggio nach und zitiert dabei das Totenphoto Che Guevaras, das die Pathosformel Caravaggios gewitzt einbezieht. Der zweifelnde Thomas evoziert die Grisaille-Technik aus Renaissance und Barock. Der bezweifelte Christus ist aber sichtlich weder verklärt noch auferstanden, sondern zeigt den Körper einer Leiche; auch hier trägt die aufgerufene Tradition das Pathos der Szene.
Die unter „Heilungen“ versammelten schwarz-weißen Bilder lassen Krankenhaus, Gefängniszelle und Psychiatrie als die drei modernen Behausungen des Leidens verschmelzen. Bildgegenstand sind nicht Kuren oder Wunder, sondern das in der Bildlichkeit des 19. Jahrhunderts zitierte Leiden. Besonders schlagend ist das Bild der Epileptikerin, das an Charcots Aufnahmen der Hysterikerinnen in der Salpêtrière und darüber hinausweisend an die Darstellung Besessener in der Kunst erinnert. Das Kreuz, das auf fast keinem dieser Bilder fehlt, ist manchmal nicht mehr als eine modische Kette, kein Zeichen verkündeter Hoffnung. Es verweist nicht auf die Überwindung des Todes und die Auferstehung des Fleisches, es zeichnet Menschen als Leidende und kann, wie im Fall der Epileptikerin, zum Zeichen dessen, was es abwehren soll, der Besessenheit, werden. Wenn diese Kranken Abbilder Gottes sind, dann sind sie es allein in dem menschlichsten Aspekt des Gottessohnes, in seinem im Fleische erlittenen Tod am Kreuz. Aber diese Teilhabe an der Passion ist nichts als Teilhabe am Leiden, die sich als die bloße, ungetröstete conditio humana erweist, und in der nichts auf Überwindung des Leidens, des Todes in Verklärung oder Wiederauferstehung hinweist. Das einzig Tröstliche an diesem Leid ist ganz von dieser Welt: eine eigenartige, befremdliche Ästhetisierung, die den Leidenden die Schönheit läßt und sich, besonders kraß, in den weiß getuschten Wimpern oder den modischen Linsen der blinden „crazy eyes“ zeigt. Anbetung, Versenkung und compassio werden dagegen in den Bildern völlig blockiert, in denen der Menschensohn nicht im Fleische leidet, sondern das Wunder der Fleischwerdung des Göttlichen gezeigt werden soll: der Verkündigung, der Anbetung der Hirten, der Heiligen Familie. Heilsgeschichte wird durch zeitgenössische Formen der Repräsentation entstellt: Touristenprospekte im Brigitte-Stil, Illustriertenphotos im Genre von Praline, Bunte oder, natürlich, Stern. In der Heilsgeschichte kommt der Verfall der Aura des Göttlichen im Profanen als Verfall von Darstellungsstilen zur Anschauung. Auf der Rückseite dieser wenig erheiternden Entwicklung wird nicht nur eine gewisse fetischistische Faszination produziert, sondern eine eigenartige Heiterkeit, ja Witzigkeit gefördert.
So mag in der Verkündigungsszene der Engel in der Hängematte auf Verkündigungen des Typus anspielen und sie widerlegen, in denen der Engel mit eigener himmlischer Kraft einfliegt. Vor allem aber zitiert das Photo das Klischee der Mittelmeerferien der gehobeneren Kategorie, der Calanques von Cassis: Pinien am blauen Himmel mit dunkelblauem Meer, Sonne, rote Blumen und, eben, die Flughilfe Hängematte. Ein Hauch Ferien mit der ganzen Familie. Das Mädchen Maria posiert unschuldig, naiv, in weißen Turnschuhen, mit heruntergerollten Söckchen, braunen, glatten, glänzenden, offenen Haaren und weißem T-Shirt, alles in allem jene fake sexiness der 70er Teenager.
Von der Anwehung des heilige Geistes, dem Einbruch des Übernatürlichen, ist nur die Eselsbrücke Hängematte übrig, Emblem entspannter Ferien. Etwas obszön, mit Mapplethorpe im Kopf, wird die Verkündigung zur metaphorischen Befruchtung. Maria liegt mit leicht geöffneten Beinen – das ist ikonographisch gedeckt – im Bett – ein Wortwitz und über sie hält der Engel eine rote Callas. Die phallischen Attribute der Blume springen ins Auge, die phallische Zurüstung hat sie für Hochzeitssträuße prädestiniert. Mapplethorpe hat diese herausragende Eignung der Callas wie sprichwörtlich gemacht.
Fröhlich grotesk, fast veschmitzt, ist die Heimsuchung: der Besuch der schwangeren Maria bei ihrer hochbetagten, hochschwangeren Cousine Elizabet, bei deren Anblick das Mädchen Maria zum ersten Mal das Kind spürt. Der hortus conclusus, Metapher für die Jungfräulichkeit Mariens, ist Gewächshaus, in der Tat ein geschlossener Garten geworden. Es würde sich lohnen, über die Technik der Literalisierung von Metaphern in der Bildersprache von Bettina Rheims nachzudenken. Dieses Photo steht in der Tradition der Portraits von Mutter und Tochter. Beide tragen glänzende, bunte Tanzröcke, mal lang, mal kurz. Die üppige Schönheit der Mitvierzigerin wird durch den billigen, wie falsche Seide glänzenden BH (Victoria’s Secret) seltsam gebrochen. Im Arm hält sie die vielleicht vierzehnjährige Tochter. Was beide dem Betrachter weisen, sind vorgeschnallte, pralle Plastikbäuche. Dem Skandalon der Fruchtbarkeit im hohen Alter wird mit teenage pregnancy gekontert – Mutter und Tochter, ein Hauch von Inzest.
Die Anbetung der Hirten zeigt eine Garage, in der Maria zwischen Benzinkanistern und Ölumfüllkannen auf einem Sack Streusalz vor einem verblaßten, von Kindern gemalten Himmel mit Sonne, Mond, Wolken, Vögeln und Sternen sitzt. Auf ihr ruht nicht der Abglanz des Göttlichen, sondern elektrisches Scheinwerferlicht. Ihm scheint diese Maria mit goldenen Slippern und türkisfarbenem Schleier als orientalisches Schönheitsklichee entsprungen; ein Schönheitsklischee, wie es den kleinen Leuten, als die diese Schäfer etwas zu modisch auftreten, in Kostümfilmen der fünziger Jahren oder auf Photos einer puppigen Märchenprinzessin gezeigt wird.
Die Heilige Familie ist eine Reflexion auf das intérieur, dessen Entwicklung mit der Darstellung der Heiligen Familie eng verbunden ist. In der nach außen abgeschlossenen, intimen Geborgenheit des Raumes entwickeln sich die innigsten, familiären Liebesbande: fürsorgliche Elternliebe, anhängliche Kinderliebe. In Rheims’ Bild sind diese Bande offenbar zerfallen; beziehungslos Mutter und Kind beim Stillen, in eben der Szene, die das symbiotische Muster der verschmelzenden Beziehungen ist. Wie ein Fremdkörper klettert das Kind auf dem Körper seiner Mutter herum, deren Körperhaltung alles andere als Zuwendung signalisiert. Wie alle Bande der Zuwendung zerschnitten sind, so zerfällt auch der Raum in eine zusammenhanglose assemblage. Der Raum der Innerlichkeit wird durch eine grundsätzliche Trennung in sich geteilt; das Äußere wird in das Innere der Fernseh-Suggestion geholt. Aber dort schafft es weder Anteilnahme noch Verbindung, sondern Radikalisierung von Ausschluß.
Das Photo zeigt ein altes Paar – Joseph leicht verbittert –, flankiert von zwei Lampen, englisches 19. Jahrhundert, mit einem Kreuz zwischen ihnen und darüber ein schwarz gerahmter Spiegel – Todesanzeige und Fernsehrahmen. Darauf erscheint wie auf einem Fernsehschirm eine nackte, leicht gebräunte Frau ausgestreckt auf einem schwarz-weiß gekachelten Steinboden, gestützt auf ein rotes Kissen, die ihre üppige, glänzende Lockenpracht nach hinten wirft. Die sexiness von Körper und Pose wird durch zu grobe Fußbekleidung – schwarze Sportsandalen – gebrochen. Ein etwa zweijähriges Kind saugt und spielt an ihren Brüsten. Das im Spiegel reflektierte Zimmer zeigt eine Ansammlung unzusammenhängender intérieur-Zitate: der schwarz-weiß gekachelte Boden ein Markenzeichen von Pieter de Hooch, die von Renaissancetapisserie überzogenen, seltsam abgeschnittenen Sessel. Die versteckte Lichtquelle läßt an das Licht eines Fernsehers denken, eine Verstärkung des intérieur gegen die Außenwelt, dessen Abgeschlossenheit keiner Liebe mehr Raum gibt, sondern einen Raum des bindungslosen Entzugs bildet. Der Genre-übliche Vorverweis auf die Passion findet sich im Kreuz unter dem Spiegel, im Rot des Nagellacks, des Kissens, des Mundes.
„Seit seiner Empfängnis“, so der bildbegleitende Text von Thomas von Aquin, „galt jeder Gedanke Christi seinem Kreuz“. Doch das Kreuz, das hier getragen werden muß, ist die verzweifelte, stumpfe Isolation, in der das alte Paar versteinert ist. Der Spiegel zeigt im Sexidol der stillenden Jungfrau alles, was sie für immer verloren haben. Die kosmetisch zurechtgetrimmte, durch Diät und Gymnastik produzierte goldene Schönheit des Fleisches aus der Reklamesphäre suggeriert eine Welt des sinnlichen Genusses, aus der sie ausgeschlossen sind. Ihr Kreuz, dem vielleicht jeder ihrer Gedanken gilt, ist die ihnen vielleicht immer schon abgehende Phantasmagorie von Jugend und Schönheit. Im scheelen Blick Josephs (regarder à travers), der neidisch und begehrlich ins abgebildete Bild blickt, wurzelt dieses Kreuz.
Die Pietà, eine der rührendsten Szenen der abendländischen Kunst, eröffnet das Buch mit dem Titel INRI, der Kreuzes-Inschrift des Pilatus. Der tote Sohn liegt im Schoß seiner Mutter. Beide sind durch die tiefbraune Seide ihres Kleides, die wie auf Bildern von Bellini auch über seinen Schoß fällt, verbunden. In der Pietà, die nicht in der Realzeit, sondern immer schon in der Ewigkeit spielt, ist die Mutter jung wie der Sohn. Der goldene Hintergrund des Mittelalters und der byzantinischen Kunst ist eine goldene Posterwand mit einem Bild des dornengekrönten Christus, das später wieder auftaucht. Aber trotz einwandfreier Ikonographie ist etwas auf diesem Bild ganz falsch. Einen ersten Hinweis gibt das „Halbseidene“, die ein wenig zu stark glänzende Seide ihres Kleides. Jesus und Maria posieren als Jesus und Maria. Als solche hergerichtet, ist ihr Blick gestellt, ein Blick, der trostlose Eindringlichkeit suggerieren soll. Nicht, daß diese Körper hergerichtet sind, ist das Problem, sondern daß sie nichts zu zeigen haben als ihre Hergerichtetheit. An den Körpern fällt die haargenaue Stilisiertheit ins Auge. Denn was diese Szene stellt, ist nichts als die Gestelltheit der Szene: die frischgewaschenen Haare, rosé Lipgloss, im Ton dazu gepuderte Wangen. Dazu ein elaboriert geschnittener Bart, perfekt der dünne Schnurrbart auf der Lippe, gezupte Augenbrauen, makellose Präpariertheit des Fleisches, das an polierten Marmor, die wahre Urszene der Darstellung, erinnert.
Pietà, Zurichtung der Szene, Zugerichtetheit der Körper. Blockade diesseitiger Anteilnahme wie jeder Tranzendenz. Das geschundene Fleisch des Menschensohns eine geschminkte, frisierte, geföhnte Leiche. Kein Zweifel, dieser Körper ist schön, von ebenmäßigem Teint, makellos gepflegt, gut genährt und trainiert. Was in ihm illusionslos aufscheint, ist das Scheinwerferlicht, in dem er liegt, und das in der glatten, gut gepeelten und gecremten Haut glänzt. Der Vorschein des Göttlichen ist ein Glanz-Makeup, resistent gegen Wasser und alle Verklärung. So ist es der Körper des Mannequins, in dem das Umkippen von der romantischen Kunst in die Mode, das postromantische Ende der Kunst seinen Ort hat. Es ist das desillusionierte Ende einer Religion, die nicht in der Hingabe an den Fetischismus der Diesseitigkeit aufgeht, ihren modischen Nachbildern und Nachstellungen den Witz der alten Konstellationen aber nicht versagt.
[*] Zu INRI von Bettina Rheims und Serge Bramly (1998).
Der Text ist aus einem an der Evangelischen Akademie Tutzingen zum Thema “Theologie des Fleisches” (Dr. Jochen Wagner) gehaltenen Vortrag hervorgegangen. Für Anregungen bedanke ich mich bei Anselm Haverkamp und Christoph Menke.
[1] Jean Rouaud (1990), 63-66, hier 65. Ich halte mich in der Nachformulierung an die Übersetzung von Annette Lallemand.
[2] „Le Seigneur écarte sa chemise pour donner à voir, avec l’audace pudique d’une jeune fille découvrant son sein, cette croix plantée entre les oreillettes prolongeant jusquèà la fin des temps les souffrances de la Passion. A voir son teint poudré, sa coiffure Louis XIII, le vendredi noir semble bien lointain.“ Rouaud (1990), 66. Alle Rouaud-Übersetzungen von mir, B.V.
[3] Die Immaculata ist „élégante comme une mannequin de haute couture, la taille marquée d’une soyeuse écharpe bleue dont les pans épousent en tombant la ligne de la cuisse. (...) Car, malgré son apparence éthérée, cette Immaculée Conception cache sous la tunique un corps plein de grâce. (...) Mystére de l’incarnation. Ceci est son corps.“ Rouaud (1990), 63, 74.
[4] Siehe ästhetische Vorläufer wie die Heiligenund Passionsserie von Pierre Gegilles (1997).
[5] Hegel (1971), 576.
[6] Hegel (1971), 566.
[7] Hegel (1971), 576.
[8] Hegel (1971), 581.
[9] Hegel (1971), 573.
[10] Rheims und Bramly geben in ihrem Apparat das Wesentliche an, zu ergänzen inzwischen durch das erhellende Werk von James Clifton (1997): The Body of Christ in the Art of Europe and New Spain, 1150-1800, das sich als Parallellektüre empfiehlt.
[11] Hegel (1971), 565.
[12] Hegel (1971), 566.
[13] Hegel (1971), 569.
[14] Hegel (1971), 588.
Bibliographie
o Bramly, Serge/Rheims, Bettina (1998): INRI. Paris: Albin Michel. Dt. Übers.: Annette Lallemand. München: Kehayoff Verlag.
o Gegilles, Pierre (1997): OEuvre complète. Paris/London, u.a.: Taschen Verlag.
o Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971): Ästhetik I/II. Hg.: Rüdiger Bubner. Stuttgart: Reclam.
o Rouaud, Jean (1990): Les champs d’honneur. Paris: Minuit.